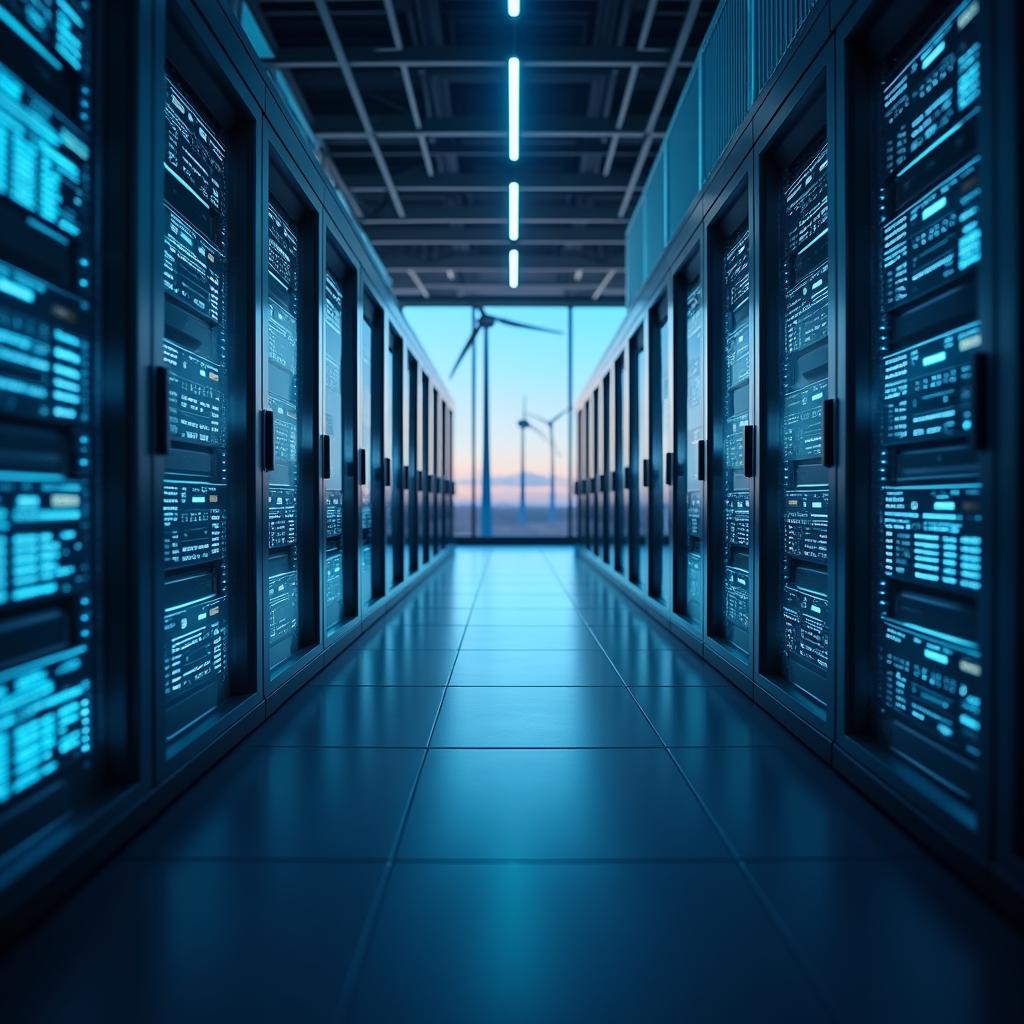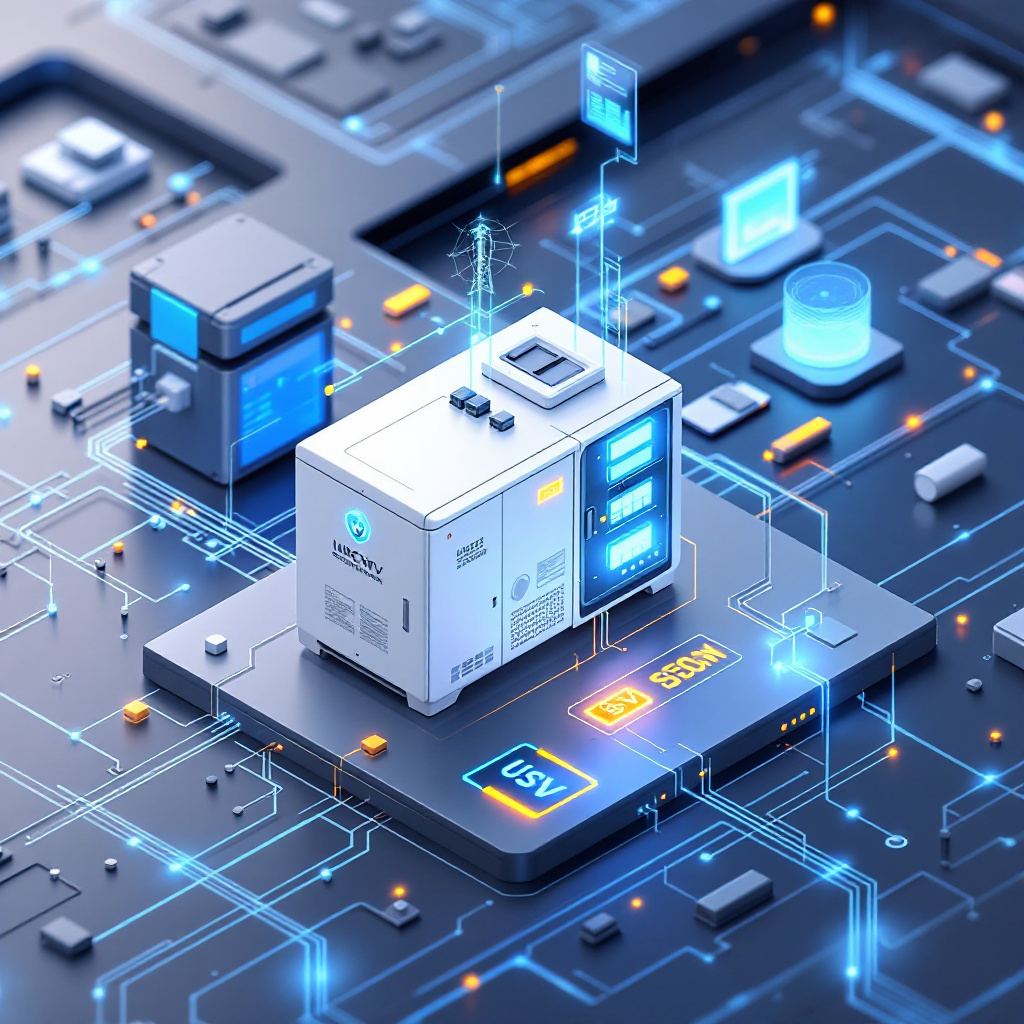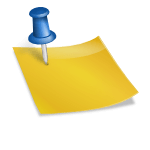Executive Summary
Die effiziente und nachhaltige Kühlung von Rechenzentren ist angesichts des exponentiellen Wachstums des digitalen Datenverkehrs und der damit verbundenen Energieintensität zu einer zentralen Herausforderung geworden. Dieser Bericht beleuchtet die physikalischen Grundlagen der Wärmeentwicklung in IT-Infrastrukturen und analysiert den steigenden Energie- und Wasserverbrauch von Rechenzentren. Es wird dargelegt, dass die Umwandlung von elektrischer Energie in Wärme ein unvermeidlicher Prozess ist, dessen effiziente Ableitung für die Systemleistung und -stabilität von entscheidender Bedeutung ist.
Der Bericht bietet einen detaillierten Überblick über etablierte und fortschrittliche Kühltechnologien, darunter luftbasierte Systeme mit optimierter Luftführung und flüssigkeitsbasierte Lösungen wie Direct-to-Chip- und Immersion-Cooling, die insbesondere für hohe Leistungsdichten unerlässlich werden. Die Bedeutung von Effizienzmetriken wie PUE (Power Usage Effectiveness), DCiE (Data Center Infrastructure Efficiency) und WUE (Water Usage Effectiveness) wird umfassend erläutert, wobei deren Stärken und Grenzen für eine ganzheitliche Bewertung der Nachhaltigkeit hervorgehoben werden.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Integration nachhaltiger Praktiken, wie der Nutzung von Abwärme für Fernwärmenetze, wasserfreien Kühllösungen und der Einbindung erneuerbarer Energien. Die Analyse zeigt, dass die Herausforderungen moderner Rechenzentren, insbesondere durch KI- und HPC-Anwendungen, innovative Ansätze wie KI-gesteuerte Kühloptimierung und modulare Lösungen erfordern. Fallstudien aus Deutschland, Europa und den USA illustrieren erfolgreiche Implementierungen und unterstreichen das Potenzial für signifikante Energie- und Wassereinsparungen.
Zusammenfassend wird festgestellt, dass die Bewältigung der Kühlherausforderungen in Rechenzentren einen integrierten Ansatz erfordert, der technologische Innovation, datengesteuerte Optimierung, Ressourcenschonung und strategische Planung miteinander verbindet, um sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die Umweltbilanz digitaler Infrastrukturen zu verbessern.
1. Einleitung: Die Bedeutung des thermischen Managements in Rechenzentren
Rechenzentren bilden das Rückgrat der digitalen Wirtschaft, indem sie immense Mengen an Daten verarbeiten, speichern und übertragen. Diese Operationen sind jedoch mit einem erheblichen Energieverbrauch verbunden, der unweigerlich zu einer massiven Wärmeentwicklung führt. Ein effektives thermisches Management ist daher nicht nur für die Zuverlässigkeit und Leistung der IT-Geräte von entscheidender Bedeutung, sondern auch für die ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit des gesamten Rechenzentrums.
1.1. Physikalische Grundlagen der Wärmeentwicklung und -ableitung in IT-Geräten
Die grundlegende Herausforderung der Rechenzentrumskühlung ist in den fundamentalen Prinzipien der Thermodynamik verankert. Nahezu die gesamte elektrische Energie, die in einem Rechenzentrum verbraucht wird, wird letztlich in Wärme umgewandelt.1 Diese Wärmeentwicklung ist eine direkte Folge des Betriebs von Servern, Speichersystemen und Netzwerkkomponenten.1 Innerhalb der Server sind Halbleiter wie CPUs, Transistoren und Spannungsregler für die Funktion verantwortlich, und aufgrund ihrer Effizienz geben diese Komponenten unweigerlich Wärme ab.4 Insbesondere intensive Prozesse wie Datenanalyse oder Virtualisierung erhöhen die Aktivität von Prozessoren und anderen Komponenten erheblich, was zu einer proportional höheren Wärmeerzeugung führt.3
Die Wärmeableitung in einem Rechenzentrum basiert auf drei grundlegenden Mechanismen:
- Wärmeleitung: Dieser Prozess beinhaltet die Übertragung von Wärme durch feste Materialien, wie beispielsweise die elektronischen Komponenten selbst und die physikalischen Strukturen von Servern. Die Wärme breitet sich durch direkten Kontakt von Bereichen höherer Temperatur zu Bereichen niedrigerer Temperatur aus.5
- Konvektion: Dieser Mechanismus betrifft die Wärmeübertragung durch Flüssigkeiten, typischerweise Luft, die um die Geräte zirkuliert.5 Innerhalb der Server transportieren interne Lüfter die Wärme von kritischen Komponenten wie CPUs und GPUs ab.3
- Wärmestrahlung: Obwohl in den vorliegenden Informationen nicht explizit detailliert, ist die Abstrahlung von Wärme von heißen Oberflächen ein weiterer grundlegender physikalischer Prozess der Wärmeübertragung.
Server arbeiten typischerweise in einem Temperaturbereich von 40°C bis 70°C unter normalen Betriebsbedingungen. Bei hoher Auslastung können diese Temperaturen jedoch auf 80°C oder höher ansteigen, was das Risiko von Hardwarefehlfunktionen und einer verkürzten Lebensdauer der Geräte birgt.3 Die Notwendigkeit einer effektiven Kühlung ergibt sich daraus, dass die Betriebstemperaturen der Komponenten innerhalb sicherer Grenzen gehalten werden müssen, um deren Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.3 Die Kühlung zielt somit nicht darauf ab, die Wärmeentwicklung zu eliminieren, sondern die unvermeidlich entstehende Wärme effizient zu managen und abzuführen.
1.2. Der wachsende Energieverbrauch und die ökologische Notwendigkeit effizienter Kühlung
Rechenzentren sind weltweit zu bedeutenden Stromverbrauchern geworden. Im Jahr 2022 machten sie schätzungsweise 1 bis 1,3 % des globalen Strombedarfs aus.6 Allein in Deutschland werden jährlich über 13 Milliarden kWh Strom in Wärme umgewandelt, die oftmals ungenutzt an die Umgebung abgegeben wird.1 Diese Entwicklung wird sich voraussichtlich fortsetzen, wobei Prognosen zeigen, dass der Energieverbrauch von Rechenzentren in der EU bis 2030 auf 3,2 % des gesamten Stromverbrauchs ansteigen könnte.7
Ein erheblicher Anteil dieses Energieverbrauchs, der in traditionellen Einrichtungen auf 30 bis 40 % geschätzt wird, entfällt auf die Kühlsysteme.2 Bei Rechenzentren, die auf herkömmliche luftbasierte Kühltechnologien setzen, können sogar bis zu 40 % der gesamten Energie nur für die Kühlung der IT-Komponenten aufgewendet werden.8 Dieser massive Energieverbrauch trägt maßgeblich zu den globalen Kohlenstoffemissionen bei 9, weshalb die Reduzierung des PUE (Power Usage Effectiveness) ein entscheidender Faktor für die Verringerung des CO2-Fußabdrucks ist.11
Die steigende Nachfrage nach Rechenleistung, insbesondere durch aufkommende Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und High-Performance Computing (HPC), verschärft diese Herausforderung zusätzlich. Während traditionelle CPU-basierte Server typischerweise mit etwa 12 kW pro Rack betrieben werden, erfordern KI-Workloads über 40 kW pro Rack, wobei eine Verdoppelung innerhalb von ein bis zwei Jahren erwartet wird.12 Diese höhere Leistungsdichte führt zu einer konzentrierteren Wärmeentwicklung auf kleinerem Raum.12 Eine höhere Wärmeerzeugung erfordert wiederum eine größere Kühlkapazität. Wenn die Kühlung ineffizient ist, verbraucht sie noch mehr Energie, was die Betriebskosten erhöht 13 und den Kohlenstoff-Fußabdruck vergrößert.9 Dies führt zu einem sich selbst verstärkenden Kreislauf, bei dem das Wachstum der Rechenanforderungen die Kühlherausforderung und ihre ökologischen Auswirkungen direkt verstärkt. Daher ist eine effiziente Kühlung nicht nur eine technische, sondern auch eine strategische und umweltpolitische Notwendigkeit.13
2. Kerntechnologien zur Rechenzentrumskühlung
Die Wahl der Kühltechnologie ist entscheidend für die Effizienz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit eines Rechenzentrums. Es gibt verschiedene Ansätze, die je nach Leistungsdichte, Standort und Umweltzielen eingesetzt werden.
2.1. Luftbasierte Kühlsysteme
Luftkühlung ist die traditionellste und am weitesten verbreitete Kühlmethode in Rechenzentren. Sie nutzt Klimaanlagen, Ventilatoren und Lüftungssysteme, um Umgebungsluft zu zirkulieren und die von der Computerausrüstung erzeugte Warmluft abzuführen.15
2.1.1. Kalt-/Warmgang-Einhausung und Luftstromoptimierung
Eine bewährte Methode zur Maximierung der Effizienz in luftgekühlten Rechenzentren ist die Konfiguration von Kalt- und Warmgängen.16 Bei dieser Anordnung werden Serverschränke in abwechselnden Reihen so positioniert, dass die Vorderseiten der Server (Lufteinlass) einen Kaltgang bilden und die Rückseiten (Luftauslass) einen Warmgang.16 Gekühlte Luft wird typischerweise über einen Doppelboden oder von oben in den Kaltgang geleitet und von den Serverlüftern angesaugt.19 Die erwärmte Abluft wird dann in den Warmgang abgegeben.16
Um die Effizienz weiter zu steigern, werden Einhausungssysteme eingesetzt, die den Kalt- oder Warmgang physisch abtrennen. Bei der Warmgang-Einhausung (Hot Aisle Containment, HAC) wird die Warmluft aus den Racks in eine Deckenkammer geleitet, von wo sie zu einer Kühleinheit transportiert und als gekühlte Luft in den Raum zurückgeführt wird.16 Bei der Kaltgang-Einhausung (Cold Aisle Containment, CAC) wird die Kaltluft im Kaltgang eingeschlossen und die Warmluft aus den Komponenten in den Warmgang geleleitet, von wo sie zur CRAC-Einheit zurückkehrt.16 Diese physische Trennung verhindert das Vermischen von warmer Abluft mit kalter Zuluft, was die Kühleffizienz erheblich steigert.17 Das Vermischen von Luft würde die Kühlkapazität reduzieren und zu Energieverschwendung führen, da bereits gekühlte Luft erneut gekühlt oder Luft gekühlt würde, die nicht direkt die IT-Geräte erreicht. Durch die Isolierung der Luftströme wird sichergestellt, dass die gekühlte Luft direkt und effizient zu den IT-Geräten gelangt.17 Dies erhöht die Rücklauftemperatur der Luft zu den Kühleinheiten 18, was wiederum deren Effizienz verbessert.20
Weitere Maßnahmen zur Luftstromoptimierung umfassen das Entfernen von Hindernissen, das Abdichten von Lecks (z. B. durch Abdeckplatten für leere Rack-Einheiten) und die optimale Platzierung von perforierten Bodenplatten zur gezielten Kühlung.17 Diese grundlegenden Praktiken des Luftstrommanagements tragen erheblich dazu bei, den Energiebedarf für die Kühlung zu senken und die PUE-Werte zu verbessern.17
2.1.2. Computer Room Air Conditioners (CRAC) und Computer Room Air Handlers (CRAH)
CRAC- (Computer Room Air Conditioner) und CRAH-Einheiten (Computer Room Air Handler) sind zentrale Komponenten luftbasierter Kühlsysteme. CRAC-Geräte arbeiten mit einem integrierten Kältemittelkreislauf: Sie saugen erwärmte Luft aus dem Rechenraum an, kühlen sie ab und führen die gekühlte Luft zurück.19 CRAH-Einheiten hingegen nutzen ein externes Kaltwassersystem zur Luftkühlung; sie nehmen ebenfalls Warmluft auf, kühlen sie und geben die gekühlte Luft wieder ab.19 Diese Einheiten werden typischerweise an den Seiten oder im hinteren Bereich des Serverraums installiert und oft mit einem Doppelbodensystem kombiniert, um die gekühlte Luft zu verteilen.19
2.1.3. Luftkühlung auf Server- vs. Rack-Ebene
Die Luftkühlung kann auf verschiedenen Ebenen erfolgen:
- Server-Ebene: Hierbei sind Lüfter direkt in den einzelnen Servern (z. B. für CPU- oder GPU-Kühlung) verbaut. Diese Methode ist für geringere Leistungsdichten geeignet, typischerweise bis zu 10 kW pro Rack.16
- Rack-Ebene: Bei diesem Ansatz sind alle Lüfter am hinteren Teil des Racks zu einer „Lüfterwand“ zusammengefasst.16 Diese Lösung ist effizienter für höhere Leistungsdichten (18 bis 20 kW pro Rack) und kann den Stromverbrauch im Vergleich zu traditionellen Methoden auf Server-Ebene um bis zu 23 % reduzieren.16
2.1.4. Vorteile und Einschränkungen
Vorteile der Luftkühlung:
- Breite Anwendbarkeit: Luftkühlung ist die am weitesten verbreitete Methode und kann in Rechenzentren jeder Größe implementiert werden.15
- Geringere Anfangsinvestitionen: Im Vergleich zu flüssigkeitsbasierten Kühlsystemen erfordert die Luftkühlung in der Regel geringere Vorabinvestitionen.22
- Bewährte Technologie: Es handelt sich um eine etablierte Technologie mit zuverlässiger Leistung für verschiedene Arten von Rechenzentren.23
Einschränkungen der Luftkühlung:
- Leistungsdichtebegrenzung: Luftkühlung ist typischerweise nur für Rack-Leistungsdichten von unter 20 kW effektiv, obwohl in Ausnahmefällen bis zu 35 kW erreicht werden können.15
- Ineffizienz bei hohen Dichten: Für Hochleistungs-Deployments, insbesondere für KI- und HPC-Workloads, die über 40 kW pro Rack erfordern, ist die Luftkühlung zunehmend ineffizient.12 Sie hat Schwierigkeiten, konzentrierte Wärmezonen effektiv abzuführen.12
- Oversizing-Bedarf: Aufgrund von Luftvermischung und Feuchtigkeitseffekten kann ein Oversizing der Klimaanlage um bis zu 30 % erforderlich sein.25
2.2. Flüssigkeitsbasierte Kühllösungen
Flüssigkeitsbasierte Kühlsysteme nutzen Kühlmittel, die durch ein Rohrnetz zirkulieren und die Wärme direkt von der IT-Ausrüstung aufnehmen.15 Flüssigkeiten sind dabei wesentlich effizienter bei der Wärmeübertragung als Luft.22
2.2.1. Direct-to-Chip (DLC) Kühlung
Funktionsweise: Direct Liquid Cooling (DLC), auch als Direct-to-Chip (DTC) bekannt, leitet gekühltes Wasser oder andere Flüssigkeiten direkt zu Kühlplatten, die auf den wärmeintensivsten Komponenten wie CPUs und GPUs montiert sind.22 Die Flüssigkeit absorbiert die Wärme direkt an der Quelle.26
Vorteile:
- Verbesserte Kühleffizienz: Durch die direkte Anwendung des Kühlmittels an der Wärmequelle wird eine wesentlich effizientere Wärmeübertragung erreicht als bei der Luftkühlung, was für Hochleistungsrechenzentren entscheidend ist.13
- Energieeinsparungen: Flüssigkeitskühlsysteme benötigen in der Regel weniger Energie als Luftkühlsysteme, was zu geringeren Betriebskosten und einem kleineren Kohlenstoff-Fußabdruck führt.13
- Erhöhte Leistung: Flüssigkeitsgekühlte Komponenten können höhere Leistungsniveaus aufrechterhalten, da sie weniger anfällig für Überhitzung sind. Dies ist besonders vorteilhaft für Anwendungen, die dauerhaft hohe Leistung erfordern, wie wissenschaftliche Berechnungen und große Simulationen.26 CPUs können länger in ihren „Boost“-Geschwindigkeiten laufen, da Flüssigkeitskühlung die CPU-Temperaturen über längere Zeiträume niedriger hält.26
- Platzoptimierung: DLC ermöglicht eine höhere Rechenleistungsdichte, da weniger Racks oder Raum für die gleiche Rechenleistung im Vergleich zu luftgekühlten Systemen benötigt werden.26
- Geringere Geräuschentwicklung: Flüssigkeitskühlsysteme arbeiten leiser, da sie weniger auf große, laute Lüfter angewiesen sind.22
Herausforderungen/Überlegungen:
- Systemkompatibilität: Server und Komponenten müssen mit Flüssigkeitskühllösungen kompatibel sein.26
- Kühlmittelauswahl: Es muss ein geeignetes Kühlmittel mit hoher Wärmeleitfähigkeit und geringer elektrischer Leitfähigkeit gewählt werden, das nicht korrosiv ist und ein geringes Leckagerisiko aufweist.26
- Pumpen- und Durchflussmanagement: Robuste Pumpen und eine zuverlässige Durchflussregelung sind erforderlich.26
- Wärmetauscherkapazität: Der Wärmetauscher muss ausreichend dimensioniert sein, um die thermische Last zu bewältigen.26
- Leckageerkennung und -prävention: Systeme zur Erkennung und Vermeidung von Leckagen sind unerlässlich.26
- Höhere Anfangskosten: Die anfänglichen Investitionskosten können höher sein als bei Luftkühlung.13
2.2.2. Rear-Door Heat Exchangers (RDHx)
Funktionsweise: RDHx-Systeme (Rear-Door Heat Exchangers) sind Flüssigkeits-Luft-Wärmetauscher, die direkt an der Rückseite von Server-Racks montiert werden.15 Sie absorbieren die Wärme aus der warmen Abluft der Server und übertragen sie auf eine zirkulierende Flüssigkeit.15 Dies reduziert die thermische Last auf das HVAC-System des Raumes erheblich.27 RDHx können passiv (ohne zusätzliche Lüfter) für moderate Wärmelasten oder aktiv (mit eingebauten Lüftern) für höhere thermische Dichten sein.27
Vorteile:
- Lokalisierte Kühlung: Direkte Kühlung an der Wärmequelle, was zu erhöhter Energieeffizienz, verbesserter Geräteleistung und reduzierten Betriebskosten führt.27
- Neutraler Raum: Kann eine „neutrale Raumumgebung“ schaffen, wodurch möglicherweise keine Kalt-/Warmgänge mehr erforderlich sind.28
- Kompatibilität mit Bestandsinfrastruktur: Oft kompatibel mit älterer IT-Hardware, was Nachrüstungen erleichtert.27
- Maximale Servergeschwindigkeit: Ermöglicht es Servern, mit maximaler Geschwindigkeit zu laufen, indem die Wärme effizient abgeführt wird.28
Herausforderungen/Einschränkungen:
- Infrastruktur für Kaltwasser: Erfordert eine Kaltwasserinfrastruktur und potenziell komplexe Verrohrungen.27
- Kapazitätsgrenzen: Kann die Kapazität vollständig flüssigkeitsgekühlter Systeme für Ultra-Hochleistungs-Workloads nicht erreichen.27
- Kosten-Effektivität: Möglicherweise nicht kosteneffektiv für Racks mit geringerem Energieverbrauch (3-6 kW/Stunde).28
- Wartung: Die Wartung kann komplexer sein und erfordert oft eine feste Verrohrung zu jeder Schranktür.28
2.2.3. Immersion Cooling (Einphasen- und Zweiphasen-Kühlung)
Funktionsweise: Bei der Immersion Cooling werden IT-Infrastrukturkomponenten direkt in dielektrische (elektrisch nicht leitende) Flüssigkeiten getaucht, die Wärme durch Absorption abführen.15
- Einphasen-Immersion Cooling: Die Flüssigkeit bleibt im flüssigen Zustand, absorbiert Wärme und zirkuliert zu einem Wärmetauscher zur Kühlung.30
- Zweiphasen-Immersion Cooling: Die Flüssigkeit verdampft beim Erhitzen. Der entstehende Dampf steigt auf, gibt Wärme durch Kondensation an einer Kühlschlange ab und kehrt in flüssiger Form zurück, wodurch ein hocheffizienter Kühlkreislauf entsteht.30
Vorteile:
- Hocheffektives Wärmemanagement: Bietet ein sehr effektives Wärmemanagement.15
- Verbesserte Energieeffizienz: Eliminiert die Notwendigkeit traditioneller Klimaanlagen, wodurch der Energieverbrauch und die Betriebskosten erheblich reduziert werden.30
- Erhöhte Leistung und Zuverlässigkeit: Verhindert Hot Spots und gewährleistet eine gleichmäßige Kühlung, was die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Hardware erhöht.30
- Platzersparnis: Kompakte Immersion-Cooling-Systeme reduzieren den physischen Platzbedarf der Kühlinfrastruktur.30
- Unterstützung anspruchsvoller Workloads: Effiziente Unterstützung für Hochleistungs- und anspruchsvolle HPC- und KI-Workloads.30
- Geringere Geräuschentwicklung: Immersion Cooling arbeitet leiser.31
- Positiver Umwelteinfluss: Potenzielle Nutzung biologisch abbaubarer Flüssigkeiten.31
Herausforderungen:
- Hohe Anfangskosten: Spezialisierte Tanks, Flüssigkeiten und kompatible Infrastruktur erfordern hohe Anfangsinvestitionen.23
- Wartungsanforderungen: Wartung erfordert speziell geschultes Personal.31
- Hardware-Kompatibilität: Nicht alle Server sind für Immersion Cooling geeignet; einige Teile müssen möglicherweise modifiziert werden.31
- Leckagerisiken: Potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Leckagen.23
- Fehlende Standards: Es gibt noch keine etablierten Normen oder Standards für Immersion Cooling.32
2.2.4. Vorteile und Herausforderungen flüssigkeitsbasierter Kühlung
Gesamtvorteile der Flüssigkeitskühlung:
- Überlegene Wärmeableitung: Flüssigkeiten leiten Wärme wesentlich effizienter ab als Luft.23
- Höhere Energieeffizienz: Führt zu niedrigeren langfristigen Betriebskosten und reduzierten Kohlenstoffemissionen.22
- Ermöglicht höhere Rechenleistungsdichte: Erlaubt mehr Rechenleistung auf kleinerem Raum.24
- Geringere Geräuschentwicklung: Systeme arbeiten leiser.22
Gesamtherausforderungen der Flüssigkeitskühlung:
- Höhere Anfangsinvestitionen: Die anfänglichen Kapitalkosten sind in der Regel höher.22
- Potenzielle Leckagen: Leckagen von Kühlmitteln können auftreten und bei unsachgemäßer Handhabung umweltschädlich sein.23
- Komplexe Installation: Die Installation ist komplexer und birgt mehrere potenzielle Fehlerquellen.23
- Wasserbedarf (für bestimmte Systeme): Einige Systeme können große Mengen an lokalem Wasser erfordern.23
Der Übergang von luftbasierten zu flüssigkeitsbasierten Kühlsystemen stellt nicht nur eine inkrementelle Verbesserung dar, sondern einen grundlegenden Paradigmenwechsel. Dieser Wandel wird durch die thermodynamischen Grenzen der Luft und die steigenden Leistungsdichten moderner IT-Systeme, insbesondere für KI und HPC, vorangetrieben.12 Die zunehmende Leistungsdichte fortschrittlicher IT-Geräte übersteigt direkt die Wärmeübertragungskapazität von Luft, was zu einem thermischen Engpass führt.12 Um die Leistung aufrechtzuerhalten und Hardwareschäden zu vermeiden 22, ist ein effizienteres Wärmeübertragungsmedium erforderlich. Flüssigkeiten sind aufgrund ihrer höheren Wärmeleitfähigkeit und spezifischen Wärmekapazität die natürliche thermodynamische Lösung.22 Dieser Wandel erfordert ein Umdenken im Serverdesign (z. B. Immersion-Ready-Server 32), in der Rechenzentrumsverrohrung 29 und in der gesamten Infrastruktur (z. B. Coolant Distribution Units, CDUs, und Verteiler 34). Obwohl die Akzeptanz noch begrenzt ist, ist das Interesse hoch, angetrieben durch die Notwendigkeit, höhere Dichte und leistungsstärkere Server zu bewältigen.35 Die Herausforderungen liegen in den Kosten und der Zuverlässigkeit, was einen signifikanten, aber anspruchsvollen Übergang kennzeichnet. Zukünftige Rechenzentren werden wahrscheinlich hybride Ansätze nutzen, die Luftkühlung für Bereiche mit geringerer Dichte und Flüssigkeitskühlung für Hochleistungszonen kombinieren.36
2.3. Freie Kühlung und Verdunstungskühlung
Diese Methoden nutzen natürliche Umweltbedingungen, um die Abhängigkeit von mechanischen Kühlsystemen zu reduzieren, was zu erheblichen Energieeinsparungen und Umweltvorteilen führt.15
2.3.1. Direkte und indirekte freie Luftkühlung
Funktionsweise: Freie Kühlung nutzt kühlere Außenluft als Wärmesenke.38
- Direkte freie Kühlung: Die Außenluft wird direkt in das Rechenzentrum geleitet, um es zu kühlen.38
- Vorteile: Eliminiert Wärmetauscher, reduziert thermischen Widerstand und Druckverlust.38 Kann bis zu 80 % der Energiekosten einsparen.16
- Nachteile: Stark wetterabhängig.16 Erfordert Befeuchtung im Winter und Entfeuchtung im Sommer; anfällig für Staub und Luftqualitätsprobleme.38
- Indirekte freie Kühlung: Die Außenluft wird über einen Wärmetauscher vom internen Rechenzentrumsklima entkoppelt.38 Die Außenluft kühlt ein Medium (z. B. Wasser), das dann das Rechenzentrum kühlt.
- Vorteile: Verhindert das Eindringen externer Verunreinigungen und Feuchtigkeitsschwankungen in das Rechenzentrum.38 In Europa und im asiatisch-pazifischen Raum beliebter.40
- Nachteile: Ein Wärmetauscher ist erforderlich, was zusätzlichen thermischen Widerstand bedeutet.38
Oft wird eine Hybridlösung eingesetzt, die direkte und indirekte Methoden je nach Außenluftfeuchtigkeit und -qualität kombiniert.38
2.3.2. Adiabatische und Verdunstungskühlungsprinzipien
- Adiabatische Kühlung: Basiert auf dem Prinzip der Wasserverdunstung, die Wärme aus der Umgebungsluft absorbiert und deren Temperatur senkt.5 Kann durch Befeuchtung der Zuluft oder über adiabatische Wärmetauscher eingesetzt werden.5
- Verdunstungskühlung: Nutzt Ventilatoren, um Außenluft anzusaugen, die dann durch Wasserverdunstung gekühlt wird, bevor sie zur Kühlung der IT-Geräte eingesetzt wird.15
Vorteile:
- Besonders effektiv in trockenen Klimazonen mit hoher Feuchtigkeitsaufnahmefähigkeit der Luft.5
- Reduziert die Abhängigkeit von mechanischer Kühlung und kann energieeffizienter sein als traditionelle Luftkühlung.5
- Kann wertvolles Trinkwasser sparen, wenn Regenwasser verwendet wird.42
Herausforderungen:
- Die Leistung ist bei ungünstigen klimatischen Bedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit) reduziert.23
- Starke Abhängigkeit von Wasserverfügbarkeit und -qualität.23
- Kann eine Neugestaltung bestehender Infrastrukturen erfordern.23
2.3.3. Klimatische Eignung und betriebliche Überlegungen
Freie Kühlung ist am effektivsten in kühleren Klimazonen.16 In Deutschland ist die Außenluft beispielsweise die meiste Zeit des Jahres kälter als 23°C.38 Die Anwendbarkeit der freien Kühlung erfordert eine Bewertung des Mikroklimas eines Standorts.15
Betriebliche Überlegungen umfassen das Management von Feuchtigkeit (Befeuchtung/Entfeuchtung) und die Filterung von Staub/Schadstoffen bei direkter Nutzung der Außenluft.38 Für Perioden, in denen die Außentemperaturen zu hoch sind, sind Backup-Kühlsysteme erforderlich.39
Obwohl freie Kühlung erhebliche Energie- und Kosteneinsparungen durch die Nutzung natürlicher Umweltbedingungen bietet, ist ihre praktische Umsetzung durch das geografische Klima und die Notwendigkeit einer strengen Luftqualitäts- und Feuchtigkeitskontrolle grundlegend eingeschränkt. Dies führt oft zu Hybridlösungen anstelle einer reinen Abhängigkeit von freier Kühlung. Der Kernvorteil der freien Kühlung besteht darin, dass sie den Energieverbrauch durch den Verzicht auf mechanische Kühlung erheblich reduziert.16 Dies führt direkt zu Energie- und Kosteneinsparungen.38 Die Effektivität ist jedoch explizit an externe Temperaturen und Feuchtigkeit gebunden.16 In wärmeren oder sehr feuchten Klimazonen nimmt ihr Nutzen ab, was den Einsatz von mechanischen Backup-Systemen erforderlich macht.39 Die direkte freie Kühlung birgt zudem Risiken wie Staub, Schadstoffe und elektrostatische Entladungen bei zu geringer Luftfeuchtigkeit oder Kondensation/Korrosion bei zu hoher Luftfeuchtigkeit.39 Dies erfordert komplexe Filter- und Befeuchtungs-/Entfeuchtungssysteme, die selbst Energie verbrauchen und Kosten verursachen.38 Das Ideal einer reinen freien Kühlung ist daher selten erreichbar; stattdessen werden oft hybride Ansätze gewählt, die freie Kühlung mit mechanischen Systemen oder indirekter freier Kühlung kombinieren, um Luftqualitätsprobleme zu mindern.23 Dies verdeutlicht einen Kompromiss zwischen der Maximierung natürlicher Kühlvorteile und der Aufrechterhaltung einer stabilen, sicheren internen Umgebung für empfindliche IT-Geräte.
3. Metriken und Standards für die Energie- und Wassereffizienz von Rechenzentren
Um die Effizienz und Nachhaltigkeit von Rechenzentren zu bewerten und zu verbessern, haben sich verschiedene Metriken und Standards etabliert.
3.1. Power Usage Effectiveness (PUE): Berechnung, Bedeutung und Einschränkungen
Berechnung: Die Power Usage Effectiveness (PUE) ist das Verhältnis der gesamten Energieaufnahme einer Einrichtung zur Energieaufnahme der IT-Ausrüstung.44
PUE = Gesamtenergieverbrauch der Einrichtung / Energieverbrauch der IT-Ausrüstung.- Der Gesamtenergieverbrauch der Einrichtung umfasst die IT-Ausrüstung, Kühlung, Beleuchtung, Sicherheit und andere Hilfssysteme.
- Der Energieverbrauch der IT-Ausrüstung bezieht sich ausschließlich auf Server, Netzwerkgeräte, Speichergeräte und andere Computerressourcen.
Bedeutung: PUE ist eine entscheidende Metrik zur Quantifizierung der Energieeffizienz. Ein niedrigerer PUE-Wert (näher an 1,0) zeigt eine höhere Effizienz an, was bedeutet, dass mehr Energie für die eigentliche Rechenleistung und weniger für den Overhead wie Kühlung verbraucht wird.11 Dies hilft, Bereiche für Effizienzverbesserungen zu identifizieren und treibt Innovationen voran.
Einschränkungen:
- Unvollständiges Bild der Gesamteffizienz: PUE misst nicht die Gesamtenergieeffizienz im ingenieurwissenschaftlichen Sinne, sondern bewertet die Effizienz der Energieverteilung innerhalb des Rechenzentrums.45 Es spiegelt nicht die Effizienz der IT-Infrastruktur selbst (Server, Speicher, Netzwerktechnologie) wider.45
- Berücksichtigt keine IT-Effizienzverbesserungen: PUE berücksichtigt nicht direkt Fortschritte in der IT-Energieeffizienz, wie sie durch das Mooresche Gesetz (Verdoppelung der Leistung pro Watt alle zwei Jahre) erzielt werden.45
- Verschlechterung bei IT-Effizienzgewinnen: Paradoxerweise kann sich der PUE-Wert verschlechtern, wenn der Stromverbrauch der IT-Ausrüstung aufgrund von Effizienzverbesserungen, flexibler Nutzung oder Abschaltung von Systemen bei geringer Last sinkt.45 Dies bedeutet, dass ein energieeffizienterer IT-Betrieb nach der PUE-Metrik weniger effizient erscheinen könnte.
- Begrenzte Vergleichbarkeit: PUE erlaubt keinen umfassenden Vergleich der Energieeffizienz zwischen verschiedenen Rechenzentren, da es die Produktivität oder den tatsächlichen Output (z. B. Rechenleistung, verarbeitete Datenmenge) nicht widerspiegelt.45 Die Norm ISO/IEC 30134-2 besagt explizit, dass PUE nicht zum Vergleich von Rechenzentren untereinander verwendet werden sollte.45
- Ausschluss wichtiger Faktoren: PUE berücksichtigt keine wichtigen Faktoren, die zur Gesamtenergieeffizienz eines Rechenzentrums beitragen, wie z. B. die IT-Auslastung, die Effizienz der Vor-Ort-Stromerzeugung, die Nutzung erneuerbarer Energien und die Abwärmenutzung.45
Typische Werte: Die Europäische Union stuft einen PUE-Wert > 2,5 als zu hoch ein; typische Werte liegen zwischen 1,1 und 2.11 Die Rechenzentren von Google erreichten 2017 einen Durchschnitts-PUE von 1,2, wobei einige Werte von 1,09 aufwiesen.44 Der globale Durchschnitts-PUE lag 2022 bei 1,55.11
Die inhärenten Einschränkungen des PUE, insbesondere seine Unfähigkeit, die Effizienz der IT-Workloads oder externe Faktoren wie die Nutzung erneuerbarer Energien zu berücksichtigen, bedeuten, dass er ein unvollständiges und manchmal irreführendes Bild der wahren Nachhaltigkeit liefert. Die Einfachheit der PUE-Berechnung ist zwar ein Vorteil 44, doch die Metrik misst nur die Effizienz der Infrastruktur (Kühlung, Stromverteilung) im Verhältnis zur IT-Last, nicht aber die Effizienz der IT-Last selbst.45 Dies kann dazu führen, dass ein Rechenzentrum mit effizienter Infrastruktur, aber ineffizienten Servern, einen guten PUE aufweist. Noch paradoxer ist, dass eine Steigerung der IT-Effizienz den PUE sogar verschlechtern kann.45 Zudem berücksichtigt PUE keine externen Faktoren wie die Energiequelle oder die Abwärmenutzung.45 Dies verdeutlicht, dass eine alleinige Fokussierung auf PUE zu suboptimalen Entscheidungen oder einem falschen Gefühl der Effizienz führen kann. Daher sind ergänzende Metriken wie DCiE, WUE, CUE und ERE 11 unerlässlich, um eine umfassendere und genauere Bewertung der Gesamtleistung eines Rechenzentrums zu ermöglichen.
3.2. Data Center Infrastructure Efficiency (DCiE)
DCiE ist der Kehrwert des PUE und wird berechnet als DCiE = Energieverbrauch der IT-Ausrüstung / Gesamtenergieverbrauch der Einrichtung.46 Er wird als Prozentsatz ausgedrückt. Ein höherer DCiE-Prozentsatz bedeutet eine höhere Effizienz, da ein größerer Teil der Energie von der IT-Ausrüstung genutzt wird.46 Ein optimaler, wenn auch praktisch unerreichbarer, DCiE-Wert wäre 100 %.46 DCiE ist wichtig, um die aktuelle Energieeffizienz eines Rechenzentrums zu bewerten, Benchmarks zu erstellen, Fortschritte bei Energiesparmaßnahmen zu verfolgen und fundierte Entscheidungen für Nachhaltigkeitsziele zu treffen.46 Die Metrik steht in direktem Zusammenhang mit der Kühleffizienz: Ein höherer DCiE weist darauf hin, dass weniger Energie für die Kühlung und andere Infrastruktur verschwendet wird.46 DCIM-Software (Data Center Infrastructure Management) kann zur Verbesserung des DCiE beitragen, indem sie Überkühlung vermeidet.46
3.3. Water Usage Effectiveness (WUE): Berechnung, Bedeutung und Verbesserungsstrategien
Berechnung: WUE misst den Wasserverbrauch im Verhältnis zum IT-Energieverbrauch. Es ist das Verhältnis des gesamten Wasserverbrauchs eines Rechenzentrums (in Litern) zur Energieaufnahme der IT-Ausrüstung (in Kilowattstunden).47
WUE = Wasserverbrauch des Rechenzentrums (Liter) / Energieverbrauch der IT-Ausrüstung (kWh).
Bedeutung: Ein niedrigerer WUE-Wert zeigt eine effizientere Wassernutzung an. Dies ist für die Nachhaltigkeit von großer Bedeutung, insbesondere in Regionen mit Wasserknappheit.6 Der durchschnittliche WUE liegt bei 1,8 L/kWh; Werte von 0,2 L/kWh oder weniger gelten als hocheffizient.
Verbesserungsstrategien:
- Erhöhung der Temperatur- und Feuchtigkeitssollwerte: Dies reduziert die Wärmeabfuhr durch Verdunstungskühlung in Kühltürmen.47
- Einsatz von recyceltem Wasser: Reduziert den Bedarf an zusätzlichem Frischwasser, erfordert jedoch möglicherweise zusätzlichen Energieaufwand für die Aufbereitung.47
- Erhöhung der Konzentrationszyklen: In Kühltürmen kann eine Erhöhung der Zyklen (z. B. von 2-4 auf 6 Zyklen) den Frischwasserbedarf und die Abwassermenge reduzieren.47
- Nutzung von DCIM-Software: Hilft bei der Optimierung des Energieverbrauchs und der Vermeidung von Überkühlung.47
3.4. ASHRAE Thermal Guidelines for Data Processing Environments
Die ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) bietet weithin anerkannte Richtlinien für Rechenzentrumsumgebungen, insbesondere durch ihre Veröffentlichung „Thermal Guidelines for Data Processing Environments“.25
Empfohlene Bereiche (Allgemein): Temperaturen sollten im Allgemeinen zwischen 18°C und 27°C liegen, der Taupunkt zwischen 5°Cdp und 15°Cdp und die relative Luftfeuchtigkeit 60%rh nicht überschreiten.25
Spezifische Geräteklassen (A1-A4, B, C): ASHRAE definiert verschiedene Klassen mit variierenden Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichen, um unterschiedliche IT-Geräte und betriebliche Flexibilität zu berücksichtigen.25 Zum Beispiel hat Klasse A1 (streng kontrollierte, kritische Operationen) einen empfohlenen Bereich von 18-27°C, während Klasse A4 (breiterer Bereich) 5-45°C zulässt.25
Auswirkungen der Feuchtigkeit: Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit (<20-30 % RH) erhöht das Risiko elektrostatischer Entladungen (ESD), die Geräte beschädigen können.25 Umgekehrt kann eine zu hohe Luftfeuchtigkeit (>55-60 % RH, oder >90 % mit Kondensation) zu Kondensation, Korrosion der Geräte, Schimmelbildung und Staubansammlung führen.25 Dies kann temporäre Ausfälle der Klimatisierung und im schlimmsten Fall Serverausfälle verursachen.55 Ineffiziente Kühlung kann zudem zu einem Abfall der Luftfeuchtigkeit und damit zu „latenter Kühlung“ führen, was eine zusätzliche Befeuchtung erfordert und den Strom- und Wasserverbrauch erhöht.17
Änderungsraten: Die Richtlinien legen auch maximale Änderungsraten für Temperatur (z. B. <5°C/h) und Feuchtigkeit (<5%rh/h) fest, um eine Belastung der Geräte zu vermeiden.49
Die ASHRAE-Richtlinien stellen einen kritischen Kompromiss zwischen der Aufrechterhaltung der Gerätezulässigkeit und der Erzielung von Energieeffizienz dar. Die Erweiterung der akzeptablen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche im Laufe der Zeit spiegelt eine pragmatische Verschiebung hin zur Nachhaltigkeit wider, indem die Widerstandsfähigkeit moderner IT-Hardware genutzt wird. Ursprünglich dienten die ASHRAE-Richtlinien dazu, den Betrieb und den Schutz empfindlicher IT-Geräte sicherzustellen.25 Mit steigenden Energiekosten und Umweltbedenken wurden die empfohlenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche jedoch erweitert.25 Dies ist darauf zurückzuführen, dass moderne IT-Geräte widerstandsfähiger gegenüber breiteren Umgebungsbedingungen sind.25 Der Betrieb bei leicht höheren Temperaturen (z. B. 22-25°C statt niedriger) ermöglicht eine stärkere Nutzung der freien Kühlung und reduziert den Energiebedarf für mechanische Kühlung.47 Dies zeigt einen direkten Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Hardware-Widerstandsfähigkeit und dem Potenzial für erhebliche Energieeinsparungen bei der Rechenzentrumskühlung. Es unterstreicht auch die Notwendigkeit, die spezifischen Toleranzen der Geräte zu kennen 25, da eine gemischte Umgebung möglicherweise einen Kompromiss erfordert. Die Richtlinien sind dynamisch und passen sich technologischen Fortschritten und Nachhaltigkeitszielen an. Die Feuchtigkeitskontrolle ist ein heikler Balanceakt: Zu niedrige Feuchtigkeit führt zu ESD 25, während zu hohe Feuchtigkeit Kondensation, Korrosion und Staubansammlung verursacht.25 Beides kann zu Hardwareschäden und Ausfallzeiten führen.53
Tabelle 1: ASHRAE Thermal Guidelines für IT-Geräteklassen
| ASHRAE Klasse | Empfohlener Temperaturbereich (°C) | Empfohlener relativer Feuchtigkeitsbereich (%) | Empfohlener Taupunktbereich (°Cdp) | Max. Änderungsrate (Temp/Feuchtigkeit) |
| A1 | 18 – 27 | 8 – 80 | -12 – 17 | <5°C/h, <5%rh/h |
| A2 | 10 – 35 | 8 – 80 | -12 – 21 | <5°C/h, <5%rh/h |
| A3 | 5 – 40 | 8 – 85 | -12 – 24 | <5°C/h, <5%rh/h |
| A4 | 5 – 45 | 8 – 90 | -12 – 24 | <5°C/h, <5%rh/h |
| B | 5 – 35 | 8 – 80 | 8 – 28 | Nicht spezifiziert |
| C | 5 – 40 | 8 – 80 | 8 – 28 | Nicht spezifiziert |
Quellen: 25
3.5. Uptime Institute Tier-Klassifizierungen: Anforderungen an Kühlsysteme und Redundanz
Das Tier-Klassifizierungssystem des Uptime Institute (Tier I-IV) ist weltweit anerkannt, um die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Rechenzentrumsinfrastruktur zu definieren.57
- Tier I (Basic): Verfügt über ein dediziertes Kühlsystem, jedoch ohne Redundanz (N-Kapazität). Erfordert jährliche Ausfallzeiten für Wartungsarbeiten.57
- Tier II (Redundante Komponenten): Bietet Redundanz (N+1) für Kühlkomponenten (Kältemaschinen, CRAC/CRAH-Einheiten). Die Verteilungskreise müssen nicht redundant sein. Erfordert weiterhin jährliche Ausfallzeiten für Wartungsarbeiten.57
- Tier III (Gleichzeitig wartbar): Alle Komponenten und Verteilungspfade sind redundant (N+1), was Wartungsarbeiten ohne Unterbrechung des IT-Betriebs ermöglicht. Bestimmte Ausfälle oder menschliche Fehler können jedoch weiterhin zu Ausfällen führen.57
- Tier IV (Fehlertolerant): Alle Komponenten und Verteilungspfade sind redundant (2N oder 2N+1) und fehlertolerant gegenüber einem einzigen Ausfall (kein Single Point of Failure). Gewährleistet „Continuous Cooling“ auch bei vollständigem Stromausfall. Es gibt keine geplanten oder ungeplanten IT-Ausfälle durch Wartung oder einzelne Fehler.57
Ein wesentlicher Aspekt der Kühlung ist, dass Tier IV ausdrücklich „Continuous Cooling“ vorschreibt, was bedeutet, dass das Kühlsystem auch bei vollständigem Stromausfall betriebsbereit bleiben muss.57
Die Uptime Institute Tiers, insbesondere in Bezug auf die Kühlredundanz, spiegeln direkt den Kompromiss zwischen der gewünschten Verfügbarkeit/Zuverlässigkeit und den damit verbundenen Kapital- und Betriebskosten wider. Höhere Tiers erfordern zunehmend komplexere und energieintensivere Kühlinfrastrukturen. Die Kernaufgabe der Tiers besteht darin, die Verfügbarkeit von Rechenzentren zu definieren und zu zertifizieren.57 Die Kühlung ist dabei explizit eine Schlüsselkomponente, die Redundanzanforderungen für höhere Tiers erfüllen muss.57 Ohne Kühlung fallen IT-Geräte aus.20 Das Erreichen höherer Tiers (z. B. Tier III oder IV) erfordert N+1- oder 2N-Redundanz für Kühlsysteme.57 Diese Duplizierung von Geräten (Kältemaschinen, CRAC/CRAH-Einheiten, Verteilungspfade) führt direkt zu erheblich höheren anfänglichen Investitionskosten sowie zu erhöhten Betriebskosten für die Wartung redundanter Systeme, selbst wenn diese nicht aktiv genutzt werden. Die Wahl des Tier-Levels ist somit eine strategische Geschäftsentscheidung, die die Kosten von Ausfallzeiten gegen die Investitionen in redundante Infrastruktur abwägt. Ein Tier-IV-Rechenzentrum, das maximale Fehlertoleranz bietet, wird bei ansonsten gleichen Bedingungen einen höheren PUE aufweisen als ein Tier-I- oder Tier-II-Rechenzentrum, da die umfangreichen redundanten Kühl- und Stromversorgungssysteme Energie verbrauchen. Dies verdeutlicht einen potenziellen „Widerspruch“, bei dem höhere Zuverlässigkeit zu geringerer Energieeffizienz führen kann, gemessen am PUE, und unterstreicht die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung der Rechenzentrumsleistung.
Tabelle 2: Vergleich der Effizienzmetriken von Rechenzentren
| Metrik | Berechnung | Misst | Idealer Wert | Typischer Bereich | Vorteile | Einschränkungen |
| PUE | Gesamtenergieverbrauch / IT-Energieverbrauch | Energieeffizienz der Infrastruktur (Overhead) | 1.0 | 1.1 – 2.0 (EU: <2.5) | Einfach, weit verbreitet, hilft bei der Identifizierung von Ineffizienzen | Misst nicht IT-Effizienz, kann sich bei IT-Effizienzgewinnen verschlechtern, begrenzt vergleichbar, schließt externe Faktoren aus |
| DCiE | IT-Energieverbrauch / Gesamtenergieverbrauch | Prozentsatz der Energie, die von IT genutzt wird | 100% | 50% – 90% | Kehrwert von PUE, intuitiver Prozentsatz, hilft bei Benchmarking und Fortschrittsverfolgung | Gleiche grundlegende Einschränkungen wie PUE in Bezug auf IT-Output und externe Faktoren |
| WUE | Wasserverbrauch (L) / IT-Energie (kWh) | Wassereffizienz | <0.01 L/kWh | 0.2 – 1.8 L/kWh | Wichtig für Nachhaltigkeit und Wasserknappheit, Fokus auf Wasserverbrauch | Berücksichtigt nicht die Wasserquelle oder die Behandlung von Abwasser |
| CUE | Kohlenstoffemissionen / IT-Energie (kWh) | Kohlenstoffeffizienz | 0.0 kgCO2eq/kWh | Variabel | Misst direkten Umwelteinfluss durch Emissionen | Berücksichtigt nicht den gesamten Lebenszyklus und indirekte Emissionen |
| ERE | Wiederverwendete Energie / Gesamtabwärme | Effizienz der Energiewiederverwendung | 1.0 | Variabel | Fördert Abwärmenutzung und Kreislaufwirtschaft | Schwierig zu messen und zu standardisieren, hängt von Abnehmern ab |
Quellen: 11
4. Schlüsselherausforderungen in der modernen Rechenzentrumskühlung
Moderne Rechenzentren stehen vor komplexen Kühlherausforderungen, die durch steigende Leistungsdichten und die Notwendigkeit der Effizienzoptimierung gekennzeichnet sind.
4.1. Management hoher Leistungsdichten und KI-/HPC-Workloads
Der Aufstieg von KI- und HPC-Workloads hat die Leistungsdichten in Rechenzentren dramatisch erhöht.12 Während traditionelle CPU-basierte Server etwa 12 kW pro Rack benötigen, erfordern KI-Workloads über 40 kW pro Rack, mit einer erwarteten Verdoppelung innerhalb von 1-2 Jahren.12 Dies führt zu konzentrierten Wärmezonen, deren Ableitung für traditionelle Luftkühlsysteme, die oberhalb von 20-35 kW pro Rack an ihre Grenzen stoßen, zunehmend schwierig wird.12
Die exponentielle Zunahme der Leistungsdichte, angetrieben durch KI- und HPC-Workloads, ist die treibende Kraft, die die Einführung der Flüssigkeitskühlung beschleunigt. Diese Entwicklung verändert das Design von Rechenzentren grundlegend und macht herkömmliche Luftkühlungsansätze für diese spezifischen Anwendungen zunehmend obsolet. Die steigende Leistungsdichte fortschrittlicher IT-Geräte übersteigt direkt die Wärmeübertragungskapazität von Luft.24 Dieser thermische Engpass 12 zwingt Rechenzentrumsbetreiber, effizientere Kühlmethoden einzuführen. Flüssigkeitskühltechnologien (DLC, Immersion Cooling) werden zu einer „Mainstream-Notwendigkeit“ und dem „Goldstandard“ für Hyperscale- und KI-Rechenzentren, da sie eine überlegene Wärmeübertragung bieten.33 Dies ist eine direkte technologische Antwort auf eine physikalische Begrenzung. Neue Infrastrukturdesigns sind erforderlich, um die immensen Verarbeitungsanforderungen der KI zu erfüllen und gleichzeitig Effizienz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.12
4.2. Erkennung und Minderung von Hot Spots und ungleichmäßiger Kühlung
Herausforderung: Die Aufrechterhaltung einer konsistenten und effizienten Kühlung in großen, komplexen Rechenzentrumssystemen ist schwierig. Schwankungen im Luft- und Wasserdurchfluss sowie Änderungen der Server-Wärmeabgabe können zu über- oder unterkühlten Bereichen und sogenannten „Hot Spots“ führen.17 Hot Spots sind lokalisierte Bereiche hoher Temperatur, die typischerweise im oberen Drittel der Server auftreten, aber überall erscheinen können, und zu Leistungsproblemen und Geräteausfällen führen können.17
Minderung:
- Echtzeitüberwachung: Durchflussmesser liefern Daten zum Durchfluss von gekühltem Wasser und Luft und helfen, Ineffizienzen und Ungleichgewichte zu erkennen.62
- Proaktive Anpassungen: Basierend auf diesen Daten können Luftstrom und Kühlkapazität angepasst werden.62
- Luftstromoptimierung: Durch Kalt-/Warmgang-Einhausung und Beseitigung von Hindernissen wird der Luftstrom optimiert.17
- Gezielte Kühlung: In-Row- und Rackmount-Kühlung kann für spezifische Hochleistungsbereiche eingesetzt werden.17
4.3. Fortschrittliche Luftstrommanagement- und Einhausungsstrategien
Herausforderung: Ineffiziente Luftströmung, wie das Vermischen von heißer Abluft mit gekühlter Luft oder Bypass-Luftströme, führt zu reduzierter Kühlkapazität und Energieverschwendung.17 Eine unzureichende Raumaufteilung ist ein Hauptgrund für überkühlte Rechenzentren.17
Best Practices:
- Kalt-/Warmgang-Konfiguration: Positionierung der Schränke Front-zu-Front und Back-zu-Back, um die Luftströme zu trennen.17
- Sichere Einhausung: Verwendung physischer Barrieren (Paneele), um Kaltluft in Kaltgängen einzuschließen und heiße Abluft zu leiten.16
- Verbesserung des Kaltluftstroms: Korrekte Platzierung von Luftdiffusoren und Gittern sowie Einsatz von In-Row-/Rackmount-Kühlung für gezielte Bereiche.17
- Beseitigung von Lecks: Abdecken leerer Rack-Einheiten mit Blindplatten und Abdichten von Kabeldurchführungen, um Bypass-Luftströme zu verhindern.17
- Entfernen von Hindernissen: Sicherstellen, dass Gänge frei sind und Kabel ordnungsgemäß verlegt sind, um den Luftstrom nicht zu blockieren.17
- Optimierung der perforierten Bodenplatten: Effektive Leitung der gekühlten Luft aus dem Doppelboden.17
4.4. Feuchtigkeits- und Staubkontrolle: Risiken und Best Practices
Die Feuchtigkeitskontrolle in Rechenzentren ist ein heikler Balanceakt, bei dem Abweichungen in beide Richtungen (zu hoch oder zu niedrig) unterschiedliche, aber gleichermaßen schädliche Risiken für die Geräteintegrität und die Betriebseffizienz darstellen, was oft zu einem sekundären Energiebedarf für Befeuchtung oder Entfeuchtung führt.
Feuchtigkeitsrisiken:
- Zu niedrig (<20-30 % RH): Erhöht das Risiko elektrostatischer Entladungen (ESD), die Geräte beschädigen können.25
- Zu hoch (>55-60 % RH, oder >90 % mit Kondensation): Kann zu Kondensation, Korrosion von Geräten, Schimmelbildung und Staubansammlung führen.25 Dies kann temporäre Ausfälle der Klimatisierung und im schlimmsten Fall Serverausfälle verursachen.55 Ineffiziente Kühlung kann zudem zu einem Abfall der Luftfeuchtigkeit und damit zu „latenter Kühlung“ führen, was eine zusätzliche Befeuchtung erfordert und den Strom- und Wasserverbrauch erhöht.17
Staubrisiken: Staubansammlungen auf IT-Geräten können Komponenten isolieren, wodurch sie schwerer zu kühlen sind. Bei feuchten Bedingungen können Zinkpartikel Kurzschlüsse verursachen.39 Außenluft, die bei freier Kühlung verwendet wird, muss gefiltert werden.16
Best Practices:
- Aufrechterhaltung idealer Feuchtigkeitswerte (z. B. 30-55 % RH, 22-25°C Temperatur).55 ASHRAE bietet spezifische Bereiche für verschiedene Geräteklassen.25
- Einsatz von Sensoren zur kontinuierlichen Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit.53
- Installation von Leckagesensoren für Wasseraustritte.55
- Strategische Positionierung von Kühleinheiten und Luftstromoptimierung zur Vermeidung ungleichmäßiger Feuchtigkeit.53
- Regelmäßige Reinigung und Inspektion von HVAC-Systemen.53
Die Feuchtigkeitskontrolle ist nicht nur eine Frage der Temperatur; sie ist ein Problem der Mehrvariablenregelung, die Temperatur, Feuchtigkeit und Luftstrom umfasst. Eine suboptimale Kontrolle in einem Bereich (z. B. Überkühlung) kann Probleme in einem anderen Bereich (z. B. niedrige Luftfeuchtigkeit) verursachen, was zu einer Kaskade von Ineffizienzen und erhöhten Betriebskosten führt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer ausgeklügelten Überwachung 53 und integrierter Managementsysteme (DCIM).46
5. Nachhaltige Kühlpraktiken und Minderung der Umweltauswirkungen
Die Suche nach nachhaltigen Kühlpraktiken entwickelt sich von der bloßen Reduzierung des Energieverbrauchs zu einem ganzheitlichen Ansatz, der die Wiederverwendung von Abwärme, Wassereinsparung und die direkte Integration erneuerbarer Energiequellen umfasst. Dies wird sowohl durch Umweltauflagen als auch durch langfristige wirtschaftliche Rentabilität vorangetrieben.
5.1. Abwärmenutzung und Energiewiederverwendung für Wärmenetze
Fast 100 % des von Servern verbrauchten Stroms wird in Wärme umgewandelt, die oft ungenutzt in die Umwelt abgegeben wird.1
Potenzial: In Deutschland könnte die Nutzung der Serverabwärme aus rund 3.000 Rechenzentren jährlich etwa 350.000 Wohnungen mit Wärme und Warmwasser versorgen.1 Europäische Serverfarmen erzeugen jährlich bis zu 50 Terawattstunden (TWh) überschüssige Wärme.1 Frankreich strebt an, die Abwärmenutzung bis 2035 auf 25-29 TWh zu steigern.66
Vorteile: Reduziert den Kohlenstoff-Fußabdruck, bietet eine stabile und vorhersehbare lokale Energiequelle, führt zu Heizkosteneinsparungen und verbessert die Energieunabhängigkeit.66
Herausforderungen:
- Temperaturdifferenz: Die Abwärme von luftgekühlten Servern ist oft niedrig (bis zu 30-40°C), während traditionelle Fernwärmenetze 80-130°C benötigen.1 Wärmepumpen sind erforderlich, um die Temperatur zu erhöhen, was Strom verbraucht.1
- Saisonale Nachfrage: Rechenzentren produzieren kontinuierlich Wärme, der Heizbedarf von Gebäuden schwankt jedoch saisonal.65 Dies erfordert die Integration mit lokalen Energieversorgern oder Pufferspeichern.65
- Nähe: Die Abwärmenutzung ist am praktikabelsten, wenn Rechenzentren geografisch nahe an potenziellen Wärmeverbrauchern liegen.66
Lösungen: Niedertemperatur-Fernwärmenetze sind kompatibler.1 Flüssigkeitsgekühlte Server erzeugen Abwärme mit höherer Temperatur (~60°C), die direkt in lokale Wärmenetze eingespeist werden kann, ohne Wärmepumpen zu benötigen.1 Die Kombination von Wärmepumpen mit erneuerbaren Energien (z. B. Photovoltaik) macht den Prozess umweltfreundlicher.1
Die Abwärmenutzung aus Rechenzentren bietet zwar erhebliche ökologische und ökonomische Vorteile, wird jedoch hauptsächlich durch die thermodynamische Diskrepanz zwischen der Abwärmetemperatur und den Anforderungen der Verbraucherseite sowie durch die logistische Herausforderung der physischen Nähe begrenzt. Dies erfordert technologische Brücken wie Wärmepumpen und eine strategische Stadtplanung. Die Wiederverwendung von Abwärme ist ein klarer Nachhaltigkeitsvorteil.66 Die Temperatur der luftgekühlten Abwärme (30-40°C) ist jedoch oft zu niedrig für traditionelle Fernwärmenetze (80-130°C).1 Dies ist eine grundlegende thermodynamische Barriere, da die Temperaturerhöhung Energie erfordert. Wärmepumpen können diese Temperaturlücke schließen 1, verbrauchen jedoch Strom, was die Umweltvorteile mindern kann, wenn dieser nicht aus erneuerbaren Quellen stammt.1 Flüssigkeitskühlung erzeugt Abwärme mit höherer Temperatur (~60°C), was eine direkte Einspeisung in einige Wärmenetze ermöglicht.1 Die Notwendigkeit der „Nähe zwischen Rechenzentren und potenziellen Wärmeverbrauchern“ 66 ist eine kritische logistische Einschränkung. Effektive Abwärmenutzung erfordert somit nicht nur technologische Lösungen, sondern auch eine Stadtplanung, die Rechenzentren in der Nähe von Wärmeverbrauchern ansiedelt oder in Niedertemperatur-Wärmenetze investiert.
5.2. Wasserfreie Kühllösungen und Wassereinsparungsinitiativen
Herkömmliche Kühlmethoden, insbesondere solche mit Kühltürmen, können erhebliche Mengen Wasser verbrauchen.67 Rechenzentren können täglich 11 bis 18 Millionen Liter Wasser verbrauchen, wobei 30-40 % durch Verdunstung verloren gehen.67
Wasserfreie Kühlung: Microsoft hat ein neues Rechenzentrumsdesign entwickelt, das die Wasserverdunstung zur Kühlung eliminiert, hauptsächlich für KI-Workloads.68 Dies geschieht durch geschlossene Kühlkreisläufe und Chip-Level-Kühlung, wodurch Wasser in einem geschlossenen Kreislauf recycelt wird, was zu einem nahezu null Wasserverbrauch für die Kühlung führt.68
Vorteile: Spart enorme Mengen an Wasser (Microsoft prognostiziert über 125 Millionen Liter/Jahr/Rechenzentrum).68 Dies ist besonders wichtig in von Dürre betroffenen Regionen.39
Wassereinsparungsinitiativen:
- Nutzung alternativer Wasserquellen wie aufbereitetes und recyceltes Wasser.68
- Erhöhung der Konzentrationszyklen in Kühltürmen.47
- Einsatz von DCI-Elektrolyse zur Wassererhaltung in Kühltürmen, wodurch monatlich Millionen Liter eingespart werden, indem Chemikalien eliminiert und die Wiederverwendung von Wasser ermöglicht wird.15
5.3. Integration erneuerbarer Energien (Solar, Wind, Geothermie) für Kühlprozesse
Die Versorgung von Rechenzentren mit erneuerbaren Energiequellen (Solar, Wind, Geothermie) ist ein ganzheitlicher Ansatz für ökologische Verantwortung.15
- Solare Kühlung: Nutzt Solarenergie zur Kälteerzeugung oder Klimatisierung.70 Solarmodule sammeln Energie, um Kühlsysteme zu betreiben, was Tausende von Euro an Stromkosten sparen und Treibhausgasemissionen reduzieren kann.70 Methoden umfassen Desikkationssysteme (Entfeuchtung) und Absorptionskältemaschinen (Umwandlung von Abwärme in Kaltluft).70
- Vorteile: Geringere Netznachfrage, reduzierte Stromkosten, weniger Stromausfälle, Off-Grid-Fähigkeiten, reduzierte Treibhausgasemissionen.70
- Nachteile: Hohe Anfangs- und Installationskosten, Intermittenz, geringe Energiedichte, lange Amortisationszeit.70
- Windenergie: Kann IT-Geräte und Kühlsysteme mit Strom versorgen.71 Effizienter als Solarenergie, da sie jederzeit Strom erzeugen kann, wenn Wind vorhanden ist.71
- Vorteile: Universelle Energiequelle, effizienter als Solar, kann kostengünstiger sein als Geothermie.71
- Einschränkungen: Intermittent und unvorhersehbar.71 Turbinen oft an abgelegenen Standorten (Lärm, visuelle Beeinträchtigung, Grundstückskosten).71 Möglicherweise keine primäre Quelle für städtische Rechenzentren.71
- Geothermische Kühlung: Nutzt stabile Untergrundtemperaturen zur Regulierung der Rechenzentrumswärme.37
- Vorteile: Wirtschaftlich und umweltfreundlich.37
Beispiele: EcoDataCenter 2 (Schweden) strebt 100 % erneuerbare Energien aus Wasser- und Windkraft an.72 Green Mountain (Norwegen) nutzt 100 % Wasserkraft und Fjordwasser zur freien Kühlung.72
5.4. Innovative Wasserquellen: Regenwassernutzung für die Kühlung
Ein Forschungsprojekt von Hoval und der Hochschule Esslingen konzentriert sich auf die Nutzung von Regenwasser für die adiabatische Kühlung.42
Mechanismus: Entwicklung einer intelligenten Regenwasserzisterne mit Steuerungsstrategien für vielfältige Anwendungen, einschließlich der Kühlung von Rechenzentren und der Bewässerung umliegender Grünflächen.42
Vorteile: Erhebliche Reduzierung des jährlichen Energiebedarfs für die Kühlung, was zu Kosteneinsparungen und einer Reduzierung der CO2-Emissionen führt.42 Vermeidet fluorierte Gase und schont wertvolles Trinkwasser.42
Die Entwicklung nachhaltiger Kühlpraktiken geht über die bloße Reduzierung des Energieverbrauchs hinaus und umfasst einen ganzheitlichen Ansatz, der die Wiederverwendung von Abwärme, Wassereinsparung und die direkte Integration erneuerbarer Energiequellen beinhaltet. Frühe Nachhaltigkeitsbemühungen konzentrierten sich hauptsächlich auf die Reduzierung des Energieverbrauchs für die Kühlung.11 Die Erkenntnis, dass die „Abwärme“ eine wertvolle Ressource ist 1, hat die Perspektive von der Wärmeableitung zur Wärmewiederverwendung verschoben, wodurch ein Nachteil in einen Vorteil umgewandelt wird.66 Dies stellt einen thermodynamischen Effizienzgewinn auf Systemebene dar, nicht nur auf Komponentenebene. Die Anerkennung des erheblichen Wasserverbrauchs 6 führt zu Wassereinsparungsbemühungen, einschließlich wasserfreier Kühlung 68 und innovativer Wasserquellen wie Regenwasser.42 Über die Menge des verbrauchten Wassers hinaus wird die Herkunft der Energie entscheidend. Die direkte Integration erneuerbarer Energien (Solar, Wind, Geothermie) in Kühlprozesse oder die Versorgung von Rechenzentren mit diesen Quellen 23 bietet einen „ganzheitlichen Ansatz für den Nachhaltigkeitsfortschritt“.15 Diese Entwicklung zeigt ein reiferes Verständnis der Rechenzentrumsnachhaltigkeit, das von isolierten Optimierungen zu integrierten, kreislaufwirtschaftlichen Prinzipien übergeht. Regulierungsrahmen 66 und Unternehmensziele 64 fördern zunehmend diese umfassenden Ansätze, wodurch sie langfristig nicht nur „grün“, sondern auch wirtschaftlich wettbewerbsfähig werden.1
6. Zukunftstrends und aufkommende Kühltechnologien
Die Kühlung von Rechenzentren befindet sich in einem stetigen Wandel, angetrieben durch den steigenden Bedarf an Rechenleistung und die Notwendigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit zu verbessern.
6.1. Fortschrittliche Flüssigkeitskühlungsinnovationen und Hybridansätze
Flüssigkeitskühlung entwickelt sich schnell zu einer Mainstream-Notwendigkeit, angetrieben durch die Anforderungen von KI/HPC.33 Der Markt für Flüssigkeitskühlung wird voraussichtlich erheblich wachsen.73
- Zweiphasen-Flüssigkeitskühlung: Es wird erwartet, dass diese Methode, bei der das Arbeitsfluid zwischen flüssigem und dampfförmigem Zustand wechselt, um Wärme hocheffizient abzuführen, in den Mainstream vordringen wird.31 Sie bietet für einige Anwendungen niedrigere Gesamtbetriebskosten über 10 Jahre als Einphasen- oder Direct-to-Chip-Kühlung.36
- Hybridsysteme: Die Kombination von Luftkühlung mit Flüssigkeitskühlung (z. B. Rear-Door Heat Exchangers mit Umgebungsluftkühlung) bietet verbesserte Energieeffizienz, gezielte Kühlung und betriebliche Flexibilität.15 Dies ermöglicht die Kühlung von Hochleistungszonen mit Flüssigkeit, während Luft für weniger anspruchsvolle Bereiche genutzt wird.36
6.2. KI-gesteuerte Kühloptimierung und prädiktive Analysen
Die Rolle der KI bei der Rechenzentrumskühlung entwickelt sich von einer Ursache für erhöhte Wärmebelastung zu einer hochentwickelten Lösung zur Optimierung des thermischen Managements. Sie ermöglicht prädiktive, dynamische und hocheffiziente Kühlsysteme, die sich an Echtzeit-Workload-Anforderungen anpassen.
Mechanismus: Fortschrittliche Analyse- und Sensorsysteme ermöglichen eine Echtzeit-Kühloptimierung.12 KI-Algorithmen analysieren Daten (Temperatur, Feuchtigkeit, Luftstrom, Workload-Muster), um die Wärmeentwicklung vorherzusagen und die effizientesten Kühlstrategien zu bestimmen.12 Anstatt statisch zu kühlen, analysiert die KI Echtzeitdaten und sagt die Wärmeentwicklung voraus.12 Dies ermöglicht eine proaktive Anpassung der Kühlressourcen.12 Wenn beispielsweise ein Anstieg der KI-Workloads erwartet wird, kann die Kühlung erhöht werden, bevor die Temperatur steigt.
Vorteile: Präzise Temperaturregelung, vorausschauende Wartung, dynamische Anpassung an variierende Workloads und erhebliche Energieeinsparungen durch Reduzierung von Überkühlung und Verschwendung.12 Ermöglicht proaktive Anpassungen anstelle reaktiver Reaktionen.12
Beispiele: Microsoft nutzt KI-Algorithmen für prädiktive Analysen, um die Energieeffizienz zu optimieren, Workloads dynamisch zu planen und Server in den Energiesparmodus zu versetzen.64 Die Fallstudie von Microsoft 64 zeigt eine prognostizierte PUE-Reduzierung von 1,6-1,8 auf 1,1-1,2 und eine Reduzierung des Kühlenergieverbrauchs von ~40 % auf ~20-25 %.
6.3. Modulare Kühlkonzepte für Rechenzentren
Modulare Rechenzentren bestehen aus vorgefertigten, standardisierten Bausteinen, die leicht konfiguriert und verschoben werden können.6
Vorteile: Schnelle Bereitstellung und Nachrüstung, insbesondere für KI-kritische Infrastrukturen.61 Vertivs „MegaMod CoolChip“ kann schlüsselfertige KI-Infrastrukturen bis zu 50 % schneller liefern.61 Ermöglicht einfache Skalierbarkeit und platzsparende Designs.7
6.4. Die Rolle von Edge-Rechenzentren in der Kühlentwicklung
Edge-Rechenzentren sind strategisch näher an Datenquellen und Benutzern platziert, um eine geringe Latenz bei der Daten- und KI-Workload-Bereitstellung zu gewährleisten.15 Ihre einzigartigen, oft kleineren und verteilten Umgebungen eröffnen innovative Kühlmöglichkeiten.15 Immersion Cooling ist für Edge Computing aufgrund seines zuverlässigen thermischen Managements in kompakten Umgebungen mit hoher Wärmeentwicklung geeignet.30
7. Fallstudien und reale Implementierungen
Reale Fallstudien belegen, dass fortschrittliche und nachhaltige Kühllösungen nicht nur theoretisch sind, sondern erfolgreich implementiert werden. Oft integrieren sie mehrere innovative Ansätze (z. B. Flüssigkeitskühlung, Abwärmenutzung, erneuerbare Energien, Wassereinsparung), um erhebliche Effizienzgewinne und Umweltvorteile zu erzielen.
7.1. Microsofts wasserfreies Rechenzentrumsdesign
Microsoft hat ein neues Rechenzentrumsdesign entwickelt, das die Wasserverdunstung zur Kühlung eliminiert, hauptsächlich für KI-Workloads.68
Mechanismus: Verwendet geschlossene Kühlkreisläufe und Chip-Level-Kühlung, wodurch Wasser in einem geschlossenen Kreislauf recycelt wird.68
Auswirkungen: Prognostizierte Wassereinsparungen von über 125 Millionen Litern jährlich pro Rechenzentrum.68 Verbesserter WUE (von 0,49 L/kWh im Jahr 2021 auf 0,30 L/kWh im Geschäftsjahr 2024).68 Ziel ist ein nahezu null Wasserverbrauch für die Kühlung im gesamten Portfolio bis Ende 2027.68
Implementierung: Pilot-Rechenzentren in Phoenix, AZ, und Mt. Pleasant, WI, sollen 2026 in Betrieb gehen. Alle neuen Microsoft-Rechenzentrumsprojekte, die seit August 2024 begonnen wurden, integrieren diese Technologie.68
7.2. Abwärmenutzungsprojekte (z. B. JH-Computers, GASAG)
- JH-Computers (Deutschland): Dieses 2019 gegründete Rechenzentrum konzentriert sich auf Green IT. Es nutzt die Serverabwärme zur Beheizung in Stödtlen, Deutschland.7 Die Lösung ermöglichte einen kompakten Rechenzentrums-Fußabdruck (250 m² gegenüber 1.500-2.000 m² bei anderen Kühlformen).7
- GASAG Solution Plus (Deutschland): Entwickelt Konzepte zur Nutzung von Rechenzentrumsabwärme für die Beheizung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Ein Projekt im Marienpark, Berlin, umfasst den Aufbau eines Nahwärmenetzes mit Investa.1
- TU Dresden (Deutschland): Ein Pilotprojekt bis 2025 wird drei Wärmepumpen nutzen, um die Abwärme eines Hochleistungsrechners (70 Racks, bis zu 24 GWh) von 40°C auf 90°C anzuheben und in das Fernwärmenetz einzuspeisen.65
- Vattenfall/Cloud&Heat (Schweden): Ein Test-Rechenzentrum verwendet flüssigkeitsgekühlte Server für KI/ML, die von einem Biomasse-befeuerten Blockheizkraftwerk angetrieben werden. Die Abwärme aus der Flüssigkeitskühlung wird in das lokale Fernwärmenetz eingespeist.72
7.3. Fortschrittliche Kühlungs-Implementierungen (z. B. Novva Datacenter, Rechenzentrum Ostschweiz AG)
- Novva Datacenter, Salt Lake City (USA): Implementierte ein verlustfreies Kühlsystem, das Serverabwärme mittels Wärmetauscher in Kühlung umwandelt. Dieses geschlossene Flüssigkeitssystem, das aquatherm-Produkte verwendet, machte zusätzliches Wasser überflüssig und löste erhebliche Wasserverlustprobleme.67
- Rechenzentrum Ostschweiz AG (Schweiz): Gilt als das energieeffizienteste Rechenzentrum der Schweiz aufgrund seiner hochentwickelten adiabatischen Kühlanlage.41 Es fungiert auch als großes Solar- und Wärmekraftwerk.41
- TierPoint, Jacksonville (USA): Nutzt seit 2014 aquatherm PP-Rohre für langlebige, energieeffiziente und korrosionsbeständige Kühlsysteme, mit Plänen für den weiteren Einsatz bei Erweiterungen.67
- Green Mountain (Norwegen): Betreibt Rechenzentren mit 100 % erneuerbarer Wasserkraft und nutzt 8°C kaltes Wasser aus angrenzenden Fjorden zur freien Kühlung über Wärmetauscher, wodurch synthetische Kältemittel vermieden werden.72
Diese Fallstudien belegen die erfolgreiche Implementierung fortschrittlicher und nachhaltiger Kühllösungen. Sie zeigen oft eine Kombination mehrerer innovativer Ansätze, um signifikante Effizienzgewinne und Umweltvorteile zu erzielen. Die theoretischen Vorteile und Herausforderungen, die in den vorherigen Abschnitten erörtert wurden (z. B. Flüssigkeitskühlung für hohe Dichte, Abwärmenutzung, wasserfreie Kühlung), werden durch diese praktischen Beispiele bestätigt. Viele Fallstudien zeigen eine Kombination von Technologien. Zum Beispiel kombiniert das Rechenzentrum Ostschweiz AG adiabatische Kühlung mit Solar-/Wärmeenergie.41 JH-Computers nutzt effiziente Kühlung und Abwärme zum Heizen.7 Microsofts wasserfreies Design verwendet geschlossene Kreisläufe und Chip-Level-Kühlung.68 Dies unterstreicht, dass eine einzige „Wunderlösung“ selten ist; stattdessen sind ganzheitliche, integrierte Designs der Schlüssel. Die Fallstudien liefern konkrete Kennzahlen des Erfolgs, wie Wassereinsparungen (Microsoft, Novva), Energieeffizienz (Rechenzentrum Ostschweiz AG) und reduzierten Platzbedarf (JH-Computers). Diese quantifizierbaren Ergebnisse untermauern die geschäftliche Begründung für nachhaltige Investitionen. Beispiele aus Deutschland, den USA, der Schweiz, Norwegen und Schweden 1 demonstrieren die globale Anwendbarkeit und regionale Anpassungen (z. B. Fjordwasserkühlung in Norwegen 72) dieser fortschrittlichen Kühlstrategien. Dies zeigt, dass Lösungen an das lokale Klima und die Ressourcenverfügbarkeit angepasst werden.
8. Fazit und strategische Empfehlungen
Die umfassende Analyse der Rechenzentrumskühlung verdeutlicht, dass es sich um eine komplexe und vielschichtige Herausforderung handelt, die einen ganzheitlichen und zukunftsorientierten Ansatz erfordert. Die digitale Transformation und das exponentielle Wachstum von datenintensiven Anwendungen wie Künstlicher Intelligenz und High-Performance Computing führen zu immer höheren Leistungsdichten, die traditionelle Kühlmethoden an ihre Grenzen bringen.
Wichtige Erkenntnisse:
- Unvermeidliche Wärmeentwicklung: Die Umwandlung von elektrischer Energie in Wärme ist ein physikalisches Gesetz, das ein effizientes thermisches Management zu einer Kernaufgabe jedes Rechenzentrums macht. Die steigende Leistungsdichte verstärkt diesen Bedarf erheblich.
- Paradigmawechsel zur Flüssigkeitskühlung: Für Hochleistungs-Workloads ist der Übergang von luftbasierten zu flüssigkeitsbasierten Kühllösungen nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit. Flüssigkeiten bieten eine überlegene Wärmeübertragung und ermöglichen höhere Rechenleistungsdichten.
- Ganzheitliche Nachhaltigkeit: Nachhaltigkeit ist über die reine Energieeffizienz hinausgewachsen und umfasst die Wiederverwendung von Abwärme, Wassereinsparung und die Integration erneuerbarer Energien. Dies wird durch ökologische Notwendigkeiten und wirtschaftliche Vorteile angetrieben.
- Bedeutung von Metriken: Metriken wie PUE, DCiE und WUE sind wertvolle Instrumente zur Bewertung der Effizienz, müssen aber in Kombination verwendet werden, um ein umfassendes Bild der Gesamtleistung und Nachhaltigkeit eines Rechenzentrums zu erhalten. Ihre Grenzen, insbesondere die des PUE bei der Abbildung der IT-Effizienz, müssen dabei berücksichtigt werden.
- KI als Optimierungslösung: Die KI, die selbst eine treibende Kraft für höhere Wärmeentwicklung ist, entwickelt sich zu einem entscheidenden Werkzeug für die dynamische und präzise Kühloptimierung durch prädiktive Analysen.
Strategische Empfehlungen:
Um den aktuellen und zukünftigen Kühlherausforderungen von Rechenzentren effektiv zu begegnen und ihre Umweltauswirkungen zu minimieren, werden folgende strategische Empfehlungen abgeleitet:
- Ganzheitliches Design und hybride Ansätze: Es wird empfohlen, integrierte Kühlstrategien zu entwickeln, die verschiedene Technologien (z. B. hybride Luft-/Flüssigkeitskühlung, freie Kühlung, Abwärmenutzung) kombinieren. Diese sollten auf spezifische Workload-Anforderungen und geografische Gegebenheiten zugeschnitten sein, um maximale Effizienz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
- Investitionen in fortschrittliche Technologien: Priorität sollte Investitionen in Flüssigkeitskühlung (Direct-to-Chip, Immersion Cooling) für Hochleistungs-Deployments eingeräumt werden. Gleichzeitig sollten modulare Kühllösungen geprüft werden, um Skalierbarkeit und schnelle Bereitstellung zu ermöglichen.
- Datengesteuerte Optimierung: Die Implementierung robuster DCIM-Systeme mit KI-gesteuerten Analysefunktionen ist unerlässlich. Dies ermöglicht Echtzeitüberwachung, vorausschauende Wartung und kontinuierliche Optimierung der Kühlleistung, um Energieverschwendung zu minimieren.
- Ressourcenzirkularität: Rechenzentrumsbetreiber sollten aktiv Möglichkeiten zur Abwärmenutzung verfolgen und wasser-effiziente Kühlpraktiken implementieren. Dazu gehören wasserfreie Designs und, wo praktikabel, die Nutzung von Regenwasser zur Kühlung.
- Integration erneuerbarer Energien: Die Stromversorgung von Kühlsystemen und Rechenzentren mit erneuerbaren Energiequellen ist entscheidend, um den Kohlenstoff-Fußabdruck zu reduzieren und langfristig Energieunabhängigkeit zu erreichen.
- Einhaltung von Standards und Richtlinien: Die kontinuierliche Überwachung und Einhaltung von ASHRAE-Richtlinien für Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche sowie den Uptime Institute Tier-Klassifizierungen ist für die Gewährleistung von Zuverlässigkeit und Effizienz unerlässlich.
- Sektorübergreifende Zusammenarbeit: Eine enge Zusammenarbeit zwischen Rechenzentrumsbetreibern, IT-Herstellern, Energieversorgern und Stadtplanern ist von großer Bedeutung. Nur durch gemeinsame Anstrengungen kann das volle Potenzial nachhaltiger Kühllösungen erschlossen und die Integration von Rechenzentren in eine zirkuläre Energiewirtschaft vorangetrieben werden.
Das Meistern der Rechenzentrumskühlung ist somit nicht nur eine technische Aufgabe zur Vermeidung von Überhitzung, sondern ein strategischer Hebel, um höhere Leistung zu ermöglichen, Betriebskosten zu senken und einen wesentlichen Beitrag zu globalen Nachhaltigkeitszielen zu leisten.
FAQ
Warum ist eine effiziente Kühlung in Rechenzentren so wichtig?
Effiziente Kühlung schützt IT-Systeme vor Überhitzung, verlängert deren Lebensdauer, senkt Betriebskosten und reduziert den Energieverbrauch sowie den CO2-Ausstoß.
Welche Technologien werden zur Kühlung von Rechenzentren eingesetzt?
Zum Einsatz kommen luftbasierte Kühlung (z. B. CRAC/CRAH, Kalt-/Warmgangeinhausung), flüssigkeitsbasierte Kühlung (Direct-to-Chip, Immersion Cooling), freie Kühlung, Verdunstungskühlung und hybride Systeme.
Was unterscheidet Direct-to-Chip- und Immersion Cooling?
Bei Direct-to-Chip-Kühlung wird Kühlflüssigkeit direkt zu wärmeintensiven Komponenten geleitet, während Immersion Cooling gesamte Hardware in ein Kühlfluid eintaucht – für maximale Effizienz bei hoher Dichte.
Welche Vorteile bietet freie Kühlung?
Freie Kühlung nutzt die Außenluft zur Kühlung und reduziert so den Energieverbrauch. Sie ist besonders effektiv in kühleren Klimazonen und kann mechanische Systeme teilweise ersetzen oder ergänzen.
Welche Risiken bestehen bei direkter freier Luftkühlung?
Risiken sind Luftverschmutzung, Staub, Feuchtigkeitsschwankungen und elektrostatische Entladungen. Diese erfordern Filtersysteme und ein präzises Feuchtigkeitsmanagement.
Welche Metriken werden zur Bewertung der Effizienz verwendet?
Häufig verwendete Kennzahlen sind PUE, DCiE, WUE, CUE und ERE. Sie messen Energie- und Wassereffizienz sowie die Wiederverwendung von Energie und Emissionen.
Warum ist der PUE-Wert allein nicht ausreichend zur Bewertung?
Der PUE berücksichtigt nur die Infrastruktur-Energieeffizienz, nicht die IT-Workload-Effizienz, die Nutzung erneuerbarer Energien oder Abwärme. Ein niedriger PUE kann irreführend sein.
Wie wirken sich Tier-Klassifizierungen auf die Kühlung aus?
Tier-III- und Tier-IV-Zertifizierungen erfordern redundante Kühlsysteme. Besonders Tier IV fordert „Continuous Cooling“, auch bei Stromausfall – was zu höherem Energieverbrauch führen kann.
Was sagen die ASHRAE-Richtlinien zur idealen Temperatur und Luftfeuchtigkeit?
Empfohlen wird ein Temperaturbereich zwischen 18 °C und 27 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 60 %. Zu hohe oder niedrige Werte erhöhen das Risiko von Ausfällen oder Korrosion.
Welche Rolle spielt Feuchtigkeitsmanagement bei der Kühlung?
Feuchtigkeit beeinflusst elektrostatische Entladungen, Kondensation und Staubbindung. Ein ausgeglichenes Feuchtigkeitsniveau ist entscheidend für den sicheren und effizienten Betrieb der IT.
Welche nachhaltigen Maßnahmen gibt es für Rechenzentrumskühlung?
Dazu zählen Abwärmenutzung, Integration erneuerbarer Energien, Regenwassernutzung, wasserfreie Kühlsysteme und die Kombination von Luft- und Flüssigkeitskühlung zur Ressourcenschonung.
Wie funktioniert die Wiederverwendung von Abwärme aus Rechenzentren?
Abwärme aus Servern kann in Wärmenetze eingespeist werden. Dazu wird sie ggf. mit Wärmepumpen auf höhere Temperaturen gebracht. Besonders Flüssigkeitskühlung erleichtert die Nutzbarkeit der Abwärme.
Welche Fallstudien zeigen erfolgreiche Kühlinnovationen?
Microsofts wasserfreies Rechenzentrum, Green Mountain in Norwegen mit Fjordwasser-Kühlung oder die TU Dresden mit Wärmepumpen für Abwärmenutzung sind Beispiele für nachhaltige Innovationen.
Wie unterstützt KI die Kühloptimierung?
KI analysiert Echtzeitdaten (Temperatur, Workload) und passt Kühlung dynamisch an. So werden Hot Spots vermieden, Energie gespart und Wartungszyklen optimiert.
Was sind Rear-Door-Heat-Exchanger (RDHx)?
RDHx sind Flüssigkeits-Wärmetauscher, die an der Rückseite von Racks montiert sind. Sie kühlen die Abluft direkt und entlasten so die Raumklimatisierung – ideal für Nachrüstungen.
Welche Zukunftstrends gibt es in der Rechenzentrumskühlung?
Trends sind KI-optimierte Kühlung, modulare Kühlkonzepte, zweiphasige Flüssigkeitskühlung, wasserfreie Designs, Integration erneuerbarer Energien und hybride Ansätze für flexible Skalierbarkeit.
Welche Unterschiede bestehen zwischen den ASHRAE-Klassen A1 bis A4?
Die ASHRAE-Klassen definieren zulässige Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche für verschiedene IT-Geräte. Klasse A1 ist für hochsensible Geräte mit engen Toleranzen (18–27 °C), während A4 deutlich höhere Temperaturen (bis 45 °C) erlaubt. Je höher die Klasse, desto flexibler ist das Gerät im thermischen Betrieb – relevant für die Wahl der Kühlstrategie.
Welche Rolle spielt der Standort bei der Planung freier Kühlung?
Freie Kühlung ist besonders effektiv in Regionen mit gemäßigtem oder kühlem Klima, sauberer Außenluft und geringer Luftfeuchtigkeit. Mikroklima, Feinstaubbelastung und Jahresmitteltemperatur beeinflussen die Eignung maßgeblich. In Deutschland kann Außenluft an über 300 Tagen im Jahr zur Kühlung beitragen.
Wie unterscheiden sich die Uptime-Tier-Stufen hinsichtlich der Kühlung?
Tier I bietet keine Redundanz und benötigt Ausfallzeiten für Wartung. Tier II hat redundante Komponenten (N+1), Tier III ist wartbar ohne Unterbrechung (vollständig redundant), und Tier IV bietet vollständige Fehlertoleranz (2N), inklusive „Continuous Cooling“ – also Kühlung auch bei Stromausfall. Mit steigendem Tier-Niveau steigen auch Energieverbrauch und Kosten.
Welche Risiken bestehen bei zu hoher oder zu niedriger Luftfeuchtigkeit?
Zu niedrige Luftfeuchtigkeit (<30 % RH) erhöht das Risiko elektrostatischer Entladungen (ESD), die elektronische Komponenten schädigen können. Zu hohe Feuchtigkeit (>60 %) kann zu Kondensation, Korrosion, Schimmelbildung und Staubbindung führen. Beide Extreme erfordern kontrollierte Luftbefeuchtung oder -entfeuchtung zur Betriebssicherheit.
Referenzen
- Abwärmenutzung aus Rechenzentren | GASAG Solution, Zugriff am August 7, 2025, https://www.gasag-solution.de/magazin/technologien/abwaerme-rechenzentrum/
- Thermodynamics of information technology data centers – ResearchGate, Zugriff am August 7, 2025, https://www.researchgate.net/publication/224123605_Thermodynamics_of_information_technology_data_centers
- How much heat does a server produce? | Bargain Hardware Blog, Zugriff am August 7, 2025, https://www.bargainhardware.co.uk/blog/blog/how-much-heat-does-a-server-produce
- How to calculate the heat dissipation of your servers and storage systems., Zugriff am August 7, 2025, https://www.starline.de/en/magazine/technical-articles/how-to-calculate-the-heat-output-of-your-servers-and-storage-systems
- Whitepaper: Kühlsysteme für Rechenzentren – EOLIOS Ingénierie, Zugriff am August 7, 2025, https://eolios.de/rechenzentrum/kuehlsysteme-fuer-rechenzentren/
- Data center – Wikipedia, Zugriff am August 7, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Data_center
- Abwärme aus dem Rechenzentrum sinnvoll nutzen – wenn … – Vertiv, Zugriff am August 7, 2025, https://www.vertiv.com/49c03c/globalassets/documents/case-studies/jh-computers-cs-de-emea_331855_0.pdf
- In Focus: Data Center Cooling Solutions | ACHR News, Zugriff am August 7, 2025, https://www.achrnews.com/articles/164160-in-focus-data-center-cooling-solutions
- Réduire la chaleur des centres de données – Intel, Zugriff am August 7, 2025, https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/cloud-computing/resources/turning-down-the-heat-on-data-centers.html
- Qu’est-ce que la gestion des centres de données? | Nlyte, Zugriff am August 7, 2025, https://www.nlyte.com/fr/faqs/quest-ce-que-la-gestion-des-centres-de-donnees/
- L’impact environnemental des centres de données : comprendre le …, Zugriff am August 7, 2025, https://www.aquaray.com/blog/articles/impact-environnemental-des-centres-de-donnees-comprendre-le-PUE
- Understanding the Design & Cooling of AI Data Centers – AIRSYS …, Zugriff am August 7, 2025, https://airsysnorthamerica.com/understanding-the-design-cooling-of-ai-data-centers/
- Direct Liquid Cooling vs. Traditional Air Cooling in Servers – Supermicro, Zugriff am August 7, 2025, https://learn-more.supermicro.com/data-center-stories/direct-liquid-cooling-vs-traditional-air-cooling-in-servers
- Switzerland Data Center Cooling Market Size, Share & Forecast, Zugriff am August 7, 2025, https://www.verifiedmarketresearch.com/product/switzerland-data-center-cooling-market/
- A guide to data center cooling: Future innovations for … – Digital Realty, Zugriff am August 7, 2025, https://www.digitalrealty.com/resources/articles/future-of-data-center-cooling
- Air Cooling in Data Centers: How Does It Work? | 2CRSi, Zugriff am August 7, 2025, https://2crsi.com/air-cooling
- Data Center Airflow Management | Volico Data Centers, Zugriff am August 7, 2025, https://www.volico.com/data-center-airflow-management-best-practices/
- Dell PowerMax-Produktreihe – Standortplanungsleitfaden PowerMax 2500 und PowerMax 8500 | Dell Deutschland, Zugriff am August 7, 2025, https://www.dell.com/support/manuals/de-de/powermax/pmax2_plang/luftstrom?guid=guid-10330d1c-c3ba-4c99-934a-2510c934d241&lang=de-de
- Wasserkühlung oder Luftkühlung für Rechenzentren?, Zugriff am August 7, 2025, https://blog.aquatherm.de/wasserkuehlung-oder-luftkuehlung-fuer-rechenzentren
- A Look at Data Center Cooling Technologies – Uptime Institute Journal, Zugriff am August 7, 2025, https://journal.uptimeinstitute.com/a-look-at-data-center-cooling-technologies/
- 6 Best Practices for Optimizing Data Center Cooling – CoreSite, Zugriff am August 7, 2025, https://www.coresite.com/blog/6-best-practices-for-optimizing-data-center-cooling
- Data Center Cooling Systems – Benefits, Differences and Comparisons, Zugriff am August 7, 2025, https://www.parkplacetechnologies.com/blog/data-center-cooling-systems-benefits-comparisons/
- L’avenir du refroidissement des data centers : des innovations éco …, Zugriff am August 7, 2025, https://www.digitalrealty.fr/resources/articles/future-of-data-center-cooling
- Principes de base du refroidissement des centres de données …, Zugriff am August 7, 2025, https://fr.boydcorp.com/blog/data-center-cooling-essentials.html
- How to Calculate Cooling Requirement for your Data Center, Zugriff am August 7, 2025, https://dataspan.com/blog/how-to-calculate-cooling-requirements-for-a-data-center/
- What Is Direct-to-Chip Liquid Cooling? – Supermicro, Zugriff am August 7, 2025, https://www.supermicro.com/en/glossary/direct-to-chip-liquid-cooling
- What Are Rear Door Heat Exchangers (RDHx)? – Supermicro, Zugriff am August 7, 2025, https://www.supermicro.com/en/glossary/rdhx
- How rear-door heat exchangers solve the high-density data center problem, Zugriff am August 7, 2025, https://teamsilverback.com/how-rear-door-heat-exchangers-solve-the-high-density-data-center-problem/
- Spécifications relatives à l’échangeur thermique à porte arrière modèle 1164-95X – IBM, Zugriff am August 7, 2025, https://www.ibm.com/docs/fr/POWER9/p9had/p9had_1164_95x_rdhx.htm
- Rechenzentrum mit Immersionskühlung – Boyd | Vertrauenswürdige …, Zugriff am August 7, 2025, https://de.boydcorp.com/blog/immersion-cooling-data-center.html
- Immersion Cooling for Data Centers: A Comprehensive Guide – E-Abel, Zugriff am August 7, 2025, https://www.eabel.com/immersion-cooling-for-data-centers/
- Immersion cooling : une technologie de refroidissement prometteuse pour les serveurs, à condition de la maitriser – APL Data Center, Zugriff am August 7, 2025, https://www.apl-datacenter.com/fr/immersion-cooling-refroidissement/
- Why Liquid Cooling Is Becoming the New Standard in Hyperscale Facilities, Zugriff am August 7, 2025, https://www.datacenters.com/news/why-liquid-cooling-is-becoming-the-new-standard-in-hyperscale-facilities
- Advanced Data Center Cooling Solutions for AI & Supercomputing …, Zugriff am August 7, 2025, https://www.gigabyte.com/Topics/Advanced-Cooling
- Uptime Institute 2024 Cooling Systems Survey: – Direct Liquid …, Zugriff am August 7, 2025, https://datacenter.uptimeinstitute.com/rs/711-RIA-145/images/2024.Cooling.Survey.Report.pdf?version=3&mkt_tok=NzExLVJJQS0xNDUAAAGT7PRR0KuLmMWcCq8tWI21qXB7omLvlzWkBrppTAcUCjbXIkzkaOxnWxRQ-ZovhNiIkKVF7w9cDt_um8_iglJ8UIxr8dE0NsyiG0wpj3cL2A
- The 2025 outlook for data center cooling – Utility Dive, Zugriff am August 7, 2025, https://www.utilitydive.com/news/2025-outlook-data-center-cooling-electricity-demand-ai-dual-phase-direct-to-chip-energy-efficiency/738120/
- Guide complet sur les techniques de refroidissement des centres de données – E-Abel, Zugriff am August 7, 2025, https://www.eabel.com/fr/guide-complet-sur-les-techniques-de-refroidissement-des-centres-de-donnees/
- Freie Kühlung von Rechenzentren – Welche … – HOWATHERM, Zugriff am August 7, 2025, https://www.howatherm.de/download/tab_11-2019_freie_k%C3%BChlung_von_rechenzentren
- News Center – Weiterentwicklung der Rechenzentrumskühlung …, Zugriff am August 7, 2025, https://www.delta-emea.com/de-de/news/29307
- Data Center Free Air Cooling Trends – Uptime Institute Blog, Zugriff am August 7, 2025, https://journal.uptimeinstitute.com/data-center-free-air-cooling-trends/
- Uptime Institute Awards, Zugriff am August 7, 2025, https://uptimeinstitute.com/uptime-institute-awards/client/rechenzentrum-ostschweiz-ag/786
- Regenwasser als Revolution in der Rechenzentrums-Kühlung …, Zugriff am August 7, 2025, https://www.hoval.de/de_DE/Regenwasser-als-Revolution-in-der-Rechenzentrums-K%C3%BChlung/news/Adiabate%20Kuehlung%20mit%20Regenwasser%20im%20Rechenzentrum
- What is PUE in Data Centers? | Supermicro, Zugriff am August 7, 2025, https://www.supermicro.com/en/glossary/pue-for-data-center
- Der PUE-Wert (power usage effectiveness) eines Rechenzentrums …, Zugriff am August 7, 2025, https://www.rechenzentren.org/rechenzentrum-klimatisierung/der-pue-wert-power-usage-effectiveness-eines-rechenzentrums/
- Stand und Entwicklung des Rechenzentrumsstandorts Deutschland, Zugriff am August 7, 2025, https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Technologie/stand-und-entwicklung-des-rechenzentrumsstandorts-deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=10
- What Is Data Center Infrastructure Efficiency (DCIE)? – Sunbird DCIM, Zugriff am August 7, 2025, https://www.sunbirddcim.com/glossary/data-center-infrastructure-efficiency-dcie
- What Is Water Usage Effectiveness (WUE)? – Sunbird DCIM, Zugriff am August 7, 2025, https://www.sunbirddcim.com/glossary/water-usage-effectiveness-wue
- Wassernutzungseffektivität (WUE) als Maßstab für die Effizienz und …, Zugriff am August 7, 2025, https://www.azuraconsultancy.com/de/water-usage-effectiveness-wue-as-metrics-for-data-center-efficiency-and-sustainability/
- 2021 Equipment Thermal Guidelines for Data Processing … – ASHRAE, Zugriff am August 7, 2025, https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/bookstore/supplemental%20files/therm-gdlns-5th-r-e-refcard.pdf
- Allgemeine Richtlinien für Rechenzentren – IBM, Zugriff am August 7, 2025, https://www.ibm.com/docs/de/power10/9080-HEX?topic=determination-general-guidelines-data-centers
- Optimisation des performances des centres de données : contrôle …, Zugriff am August 7, 2025, https://www.processsensing.com/fr-fr/blog/centre-donnees.htm
- DATA CENTER – Legrand Group, Zugriff am August 7, 2025, https://www.legrandgroup.com/sites/default/files/Documents_PDF_Legrand/Nos_solutions/EXB13089_DataCenter-FR.pdf
- Humidity Control in Data Centers: The Silent Threat to Uptime and Equipment Lifespan, Zugriff am August 7, 2025, https://ultrapureus.com/humidity-control-in-data-centers/
- Humidity Control in Data Centers.03242017_0.pdf, Zugriff am August 7, 2025, https://datacenters.lbl.gov/sites/default/files/Humidity%20Control%20in%20Data%20Centers.03242017_0.pdf
- Wirkungsvoller Schutz von Elektronik in Rechenzentren – Thermokon, Zugriff am August 7, 2025, https://www.thermokon.de/unternehmen/neuigkeiten/presseberichte/wirkungsvoller-schutz-von-elektronik-in-rechenzentren
- Système de Refroidissement respectant les standards ASHRAE – Etix Everywhere, Zugriff am August 7, 2025, https://www.etixeverywhere.com/fr/caracteristiques-refroidissement/
- Uptime Institute — Wikipédia, Zugriff am August 7, 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Uptime_Institute
- Datacenters : Les techniques de refroidissement liquide IA – Filière 3e, Zugriff am August 7, 2025, https://www.filiere-3e.fr/2024/12/05/datacenters-les-techniques-de-refroidissement-liquide-repondent-aux-nouvelles-exigences-de-la-tres-haute-densite-de-lia/
- Data Centers in the AI Era: Shaping the Future of the Data Center Industry | EY Japan, Zugriff am August 7, 2025, https://www.ey.com/en_jp/insights/tmt/data-centers-in-the-ai-era-shaping-the-future-of-the-data-center-industry
- Data Center Trends & Cooling Strategies to Watch in 2025 – AIRSYS North America, Zugriff am August 7, 2025, https://airsysnorthamerica.com/data-center-trends-cooling-strategies-to-watch-in-2025/
- Strom und Kühlung im KI-Datacenter: Vertiv und Nvidia stellen …, Zugriff am August 7, 2025, https://www.crn.de/news/2024/strom-und-kuhlung-im-ki-datacenter-vertiv-und-nvidia-stellen-gemeinsames-konzept-vor
- Top 5 Challenges of Cooling Modern Data Centers and How Flow …, Zugriff am August 7, 2025, https://www.onicon.com/education-series/top-5-challenges-of-cooling-modern-data-centers-and-how-flow-meters-solve-them
- Comment éliminer les points chauds des centres de données ? [ juin 2025 ] – E-Abel, Zugriff am August 7, 2025, https://www.eabel.com/fr/comment-eliminer-les-points-dacces-des-centres-de-donnees/
- Case Study: AI-Powered Dynamic Liquid Cooling to Optimize Microsoft’s Data Center Efficiency | by Eric Wang | Medium, Zugriff am August 7, 2025, https://medium.com/@ericwang4352/case-study-ai-powered-dynamic-liquid-cooling-to-optimize-microsofts-data-center-efficiency-26223ec7d94f
- Abwärme nutzen, Zugriff am August 7, 2025, https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/1_Ministerium/Aufgaben_und_Organisation/Green-IT/Green-IT-Abwaerme-nutzen.pdf
- La récupération de chaleur des data centers : un levier stratégique pour la transition énergétique des collectivités | Idex, Zugriff am August 7, 2025, https://www.idex.fr/le-blog/la-recuperation-de-chaleur-des-data-centers-un-levier-strategique-pour-la-transition-energetique-des-collectivites
- Kühltechnologie für Anbieter von Rechenzentren | aquatherm …, Zugriff am August 7, 2025, https://www.aquatherm.de/loesungen-produkte/branchen/kuehltechnologie-fuer-anbieter-von-rechenzentren/
- Microsoft Rechenzentren der nächsten Generation verbrauchen …, Zugriff am August 7, 2025, https://news.microsoft.com/de-de/datencenter-kuehlung/
- Optimiser la consommation d’énergie dans un data center | Covalba, Zugriff am August 7, 2025, https://www.covalba.fr/blog/gestion-temperature-data-center
- What is Solar Cooling? Solar Cooling Systems Explained – C&C Technology Group, Zugriff am August 7, 2025, https://cc-techgroup.com/solar-cooling/
- The pros and cons of wind power for data center sustainability, Zugriff am August 7, 2025, https://www.invt-power.com/News_details/The_pros_and_cons_of_wind_power_for_data_center_sustainability.html
- Klimaneutralität und Energie- effizienz von Rechenzentren – Best Practice Beispiele, Zugriff am August 7, 2025, https://www.centraloffice2030.de/file/show/35/9d95d1/CO203-Klimaneutrale%20RZ%20final.pdf
- Taille et tendances du marché du refroidissement des centres de données 2031, Zugriff am August 7, 2025, https://www.theinsightpartners.com/fr/reports/data-center-cooling-market
- Comment l’IA peut aider les data centers éco-responsables en révolutionnant l’efficacité énergétique | Digital Realty, Zugriff am August 7, 2025, https://www.digitalrealty.fr/resources/articles/sustainable-data-centre-ai