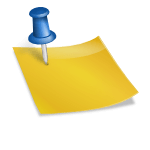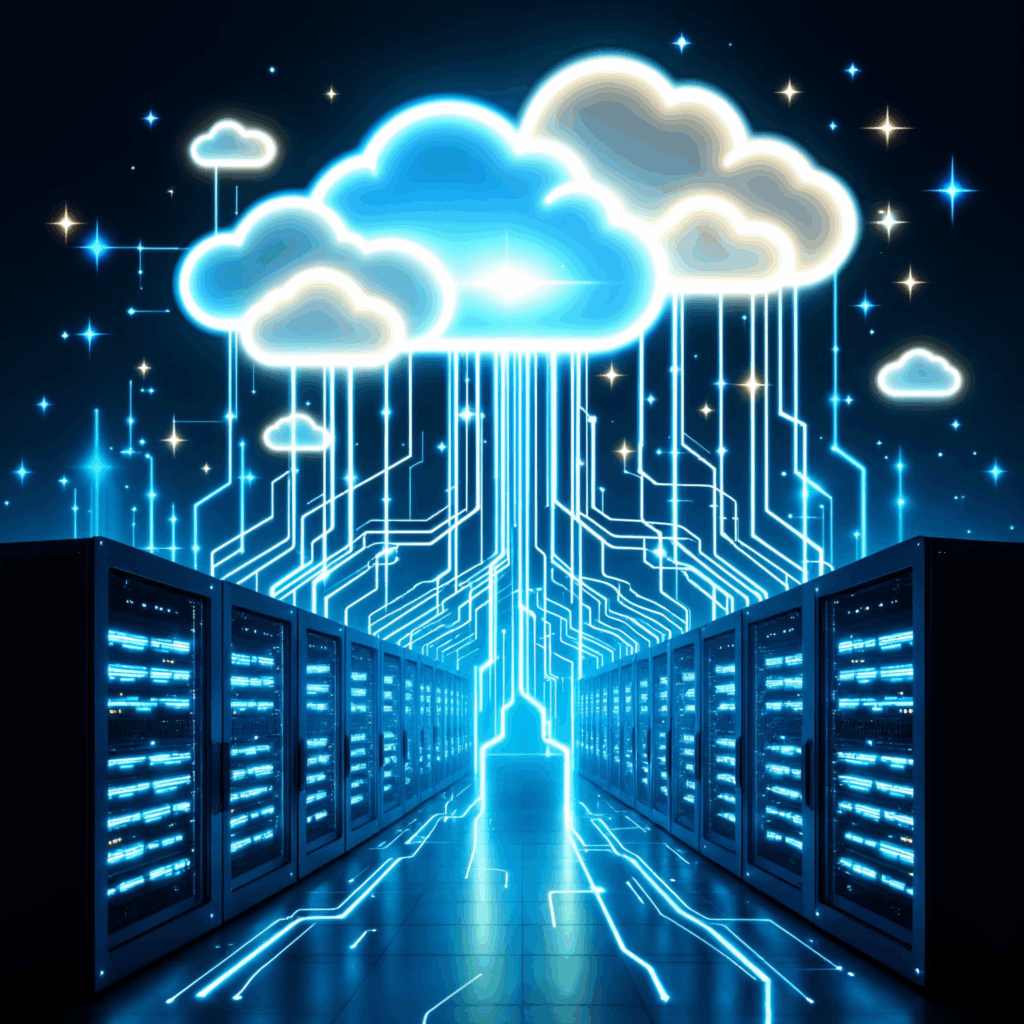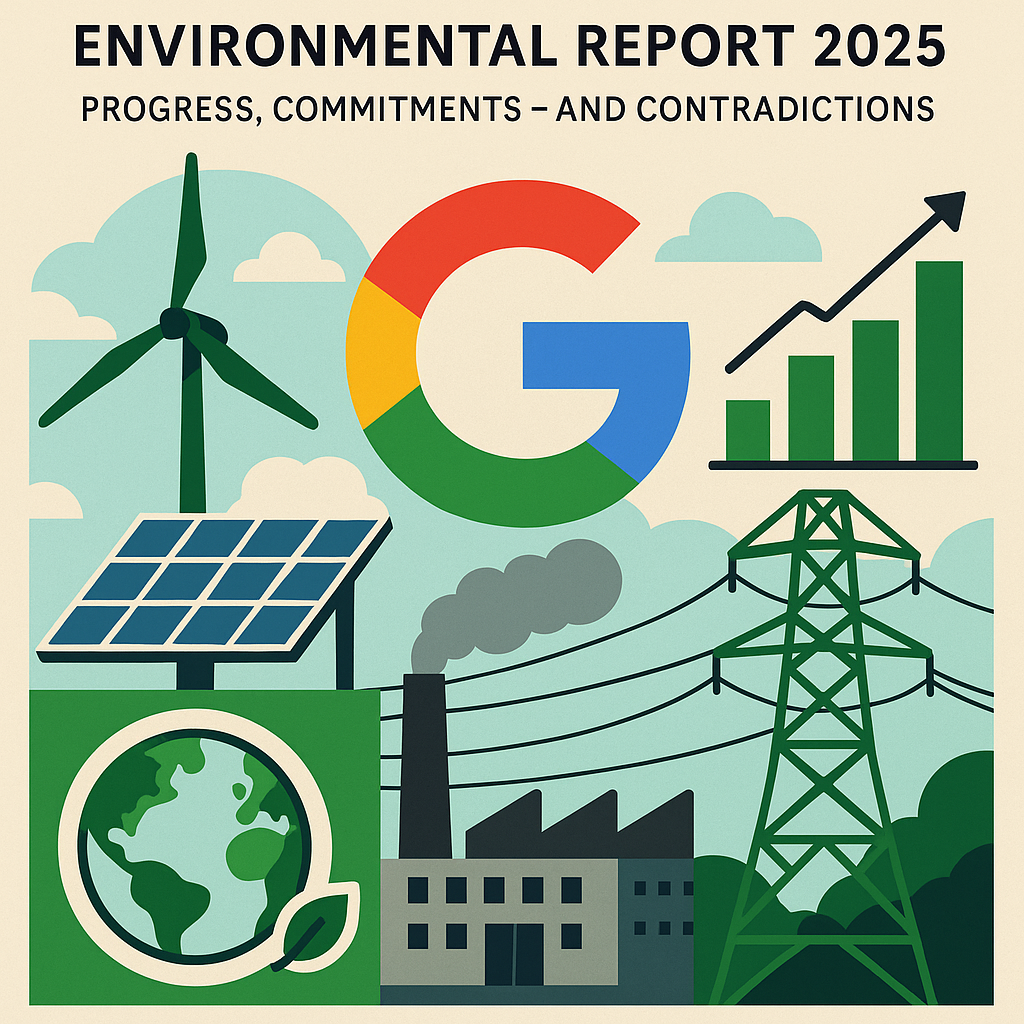Power-Crunch in FLAPD: Strom wird zum Engpass für Europas Rechenzentren
Wie Strommangel die Wachstumsperspektiven in Frankfurt, London, Amsterdam, Paris und Dublin bedroht

Europa digitalisiert sich – aber der Strom fehlt. Während Cloud-Dienste, künstliche Intelligenz (KI) und datenintensive Anwendungen exponentiell wachsen, droht der Ausbau der Energieinfrastruktur zurückzubleiben. Besonders betroffen sind die sogenannten FLAPD-Städte (Frankfurt, London, Amsterdam, Paris, Dublin), die bisher als Rückgrat der europäischen Colocation-Landschaft galten.
Strombedarf überholt den Netzausbau
Laut dem aktuellen EUDCA-Report 2025 sehen 76 % der befragten Betreiber den Zugang zu Energie als größte Herausforderung der kommenden drei Jahre. Der Strombedarf der Branche steigt jährlich um etwa 15 %, vor allem durch Hochleistungs-Computing, Flüssigkühlung und KI-Infrastrukturen. Allein Frankfurt rechnet 2025 mit einem Zuwachs von 130 MW – das entspricht einer Verdopplung gegenüber den durchschnittlichen Ausbauzahlen der Vorjahre.
Beispiel Brandenburg: Ambitionen vs. Realität
Brandenburg verdeutlicht, wie konkret der sogenannte Power-Crunch bereits geworden ist – also ein Engpass bei der elektrischen Versorgung, der entsteht, wenn die geplante Nachfrage nach Stromanschlüssen das vorhandene Netz deutlich überfordert: In Ludwigsfelde betreibt Vantage Data Centers vier große Anlagen, die zusammen 84 MW Anschlussleistung benötigen – vergleichbar mit dem Jahresbedarf einer Stadt wie Cottbus. Obwohl die Region über viel Wind- und Solarstrom verfügt, fehlt es an ausreichender Netzinfrastruktur.
Edis ist der regionale Verteilnetzbetreiber für Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und ist verantwortlich für Planung, Ausbau und Betrieb des Stromverteilnetzes. Dort steht man jedoch derzeit stark unter Druck, weil deutlich mehr Rechenzentrumsprojekte Anschlussleistung nachfragen, als das bestehende Netz bereitstellen kann.
2024 wurden allein in Brandenburg 60 neue Rechenzentrumsprojekte gemeldet – mit einem Gesamtbedarf von etwa 9.000 MW. Das bestehende Edis-Netz kommt hingegen auf eine maximale Jahreshöchstlast von lediglich 2.400 MW. Diese Schere zeigt deutlich, dass selbst wirtschaftlich tragfähige Projekte häufig an der fehlenden Anbindung scheitern.
Engpässe treiben Standortverlagerung
Auch im FLAPD-Raum spitzt sich die Lage zu. Die Leerstandsquote in Frankfurt liegt inzwischen bei unter vier Prozent, wie CBRE berichtet. In Amsterdam und Dublin verhindern Engpässe bei der Netzanbindung bereits konkrete Bauvorhaben. Investoren orientieren sich daher zunehmend an sekundären Märkten wie Mailand, Berlin oder Warschau, wo Netzkapazitäten und Flächen noch verfügbar erscheinen.
Auch dort drohen jedoch ähnliche Engpässe: langsame Genehmigungsprozesse, langwieriger Netzausbau und zunehmender Konkurrenzdruck durch weitere Großverbraucher wie Wärmepumpen, E-Mobilität und Industrieanlagen. Die Dynamik des Rechenzentrumsbaus überholt die Taktung der Energieplanung.
Politischer Wille allein genügt nicht
Der Fall Brandenburg macht deutlich, dass politische Zielsetzungen nicht automatisch zu technischer Realisierung führen. Obwohl der Bund den Aufbau digitaler Infrastruktur explizit fördert – insbesondere im strukturschwachen Osten – bleiben zentrale Voraussetzungen wie gesicherte Stromanschlüsse oft aus. Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz bestätigt, dass 2025 bislang kein einziges der beantragten Großzentren in Brandenburg bislang an das Hochspannungsnetz angeschlossen ist – trotz konkreter Pläne und hoher Investitionszusagen.
Energiezugang wird zum entscheidenden Standortfaktor
Lange galt Konnektivität als wichtigster Entscheidungsfaktor bei der Wahl eines Rechenzentrumsstandorts. Heute verschieben sich die Prioritäten: Der Zugang zu erneuerbaren Energien und belastbarer Netzinfrastruktur wird zum entscheidenden Standortvorteil. Regionen wie Extremadura in Spanien oder Teile Skandinaviens setzen gezielt auf diese Kombination, um sich im europäischen Wettbewerb zu behaupten.
Fazit: Ohne Strom keine digitale Souveränität
Die europäische Rechenzentrumsbranche steht an einem kritischen Punkt. Der Energiebedarf wächst schneller als die Infrastruktur, politische Zusagen laufen ins Leere, und Investoren weichen zunehmend in Regionen mit stabilerer Versorgungslage aus. Brandenburg ist ein warnendes Beispiel dafür, wie ambitionierte Projekte ohne Netzanbindung ins Stocken geraten.
Digitalisierung braucht Strom – und zwar planbar, nachhaltig und verfügbar. Schneller Netzausbau, verbindliche Genehmigungsverfahren und eine vorausschauende Standortstrategie sind notwendig, damit Europa im globalen Infrastrukturwettlauf nicht den Anschluss verliert.
Was bedeutet der Begriff Power-Crunch in Rechenzentren?
Power-Crunch beschreibt einen Engpass in der Stromversorgung von Rechenzentren. Er entsteht, wenn der Bedarf an elektrischer Anschlussleistung schneller wächst als das Stromnetz bereitstellen kann.
Warum sind die FLAPD-Städte besonders betroffen?
Frankfurt, London, Amsterdam, Paris und Dublin sind die leistungsstärksten Colocation-Standorte Europas. Dort konzentriert sich die Nachfrage – aber der Netzausbau hält mit dem Wachstum nicht Schritt.
Wie hoch ist der Strombedarf in Frankfurt laut Prognose 2024?
Für 2024 wird ein zusätzlicher Strombedarf von rund 130 MW erwartet – doppelt so viel wie im Durchschnitt der Vorjahre.
Was zeigt das Beispiel Brandenburg in Bezug auf Netzinfrastruktur?
In Brandenburg wurden 2024 Rechenzentrumsprojekte mit rund 9.000 MW Bedarf gemeldet – das regionale Netz (Edis) kann aber nur 2.400 MW bereitstellen. Der Mangel an Anschlusskapazitäten blockiert viele Vorhaben.
Welche Rolle spielt Edis im Stromnetz?
Edis ist der regionale Verteilnetzbetreiber für Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Das Unternehmen ist für die Planung, den Ausbau und den Betrieb des Stromnetzes verantwortlich.
Warum reicht politischer Wille allein nicht aus?
Obwohl Rechenzentren politisch gefördert werden, fehlt es oft an technischer Umsetzbarkeit – etwa durch langsame Genehmigungen und fehlende Leitungsinfrastruktur.
Welche Regionen gelten als Alternativen zu FLAPD?
Mailand, Berlin, Warschau sowie Regionen in Spanien oder Skandinavien gelten als Alternativen – oft wegen verfügbarer Flächen, Netzkapazitäten oder erneuerbarer Energien.
Was fordert der Artikel als Lösung?
Der Artikel plädiert für einen schnelleren Netzausbau, klarere Genehmigungsverfahren und eine proaktive Standortplanung, damit Europa seine digitale Wettbewerbsfähigkeit erhält.