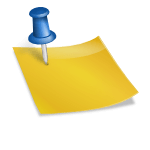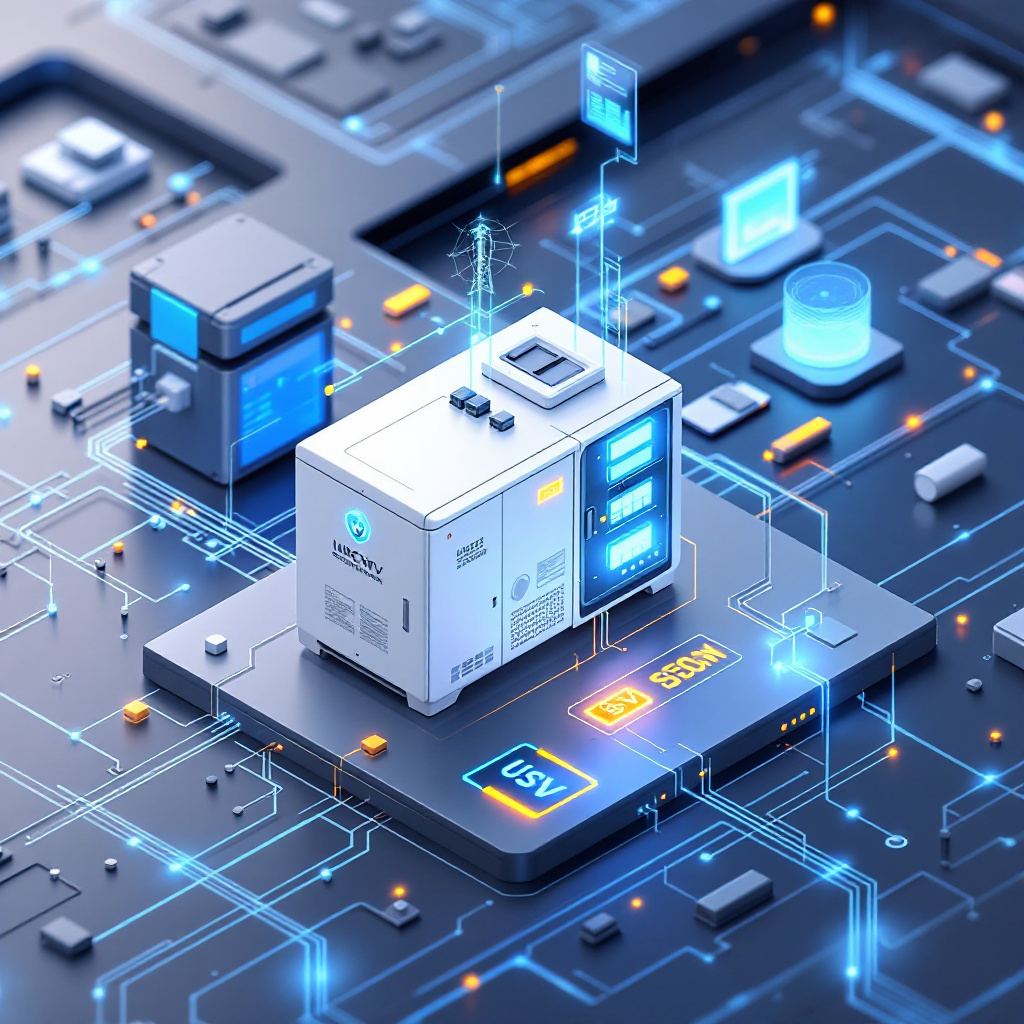Künstliche Intelligenz treibt den globalen Strombedarf in neue Dimensionen. Einzelne Trainingsläufe könnten bis 2030 bis zu 16 GW verschlingen – so viel wie ganze Metropolen. Warum Strom zum zentralen Bottleneck der KI wird und welche Folgen das für Rechenzentren, Netze und Klimaziele hat.

Einleitung
Die rasante Weiterentwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) stellt nicht nur Forschung und Wirtschaft vor neue Chancen, sondern auch die Energieversorgung vor große Herausforderungen. Aktuelle Analysen – darunter ein Whitepaper des Electric Power Research Institute (EPRI) in Zusammenarbeit mit Epoch AI zeigen, dass nicht nur der Wasserbrauch von KI Herausforderungen birgt sondern auch der Strombedarf durch bis 2030 Dimensionen erreicht, die weit über klassische IT-Infrastrukturen hinausgehen.
Frontier-Trainings und ihre Stromlast
EPRI und Epoch AI weisen darauf hin, dass einzelne Trainingsläufe führender Modelle bereits heute eine Leistung von 100 bis 150 Megawatt beanspruchen. Bis 2028 könnte der Bedarf pro Training auf 1 bis 2 Gigawatt, bis 2030 auf 4 bis 16 Gigawatt steigen. Damit würde der Energieverbrauch einzelner KI-Projekte in die Größenordnung großer Kraftwerkskapazitäten vorstoßen.
| Leistung | Vergleich mit Haushalten / Städten |
|---|---|
| 100 MW | ca. 80.000–100.000 Haushalte |
| 1 GW | Strombedarf einer Stadt mit ~1 Mio. Einwohner |
| 4 GW | Strombedarf einer Metropole wie Berlin oder Los Angeles |
| 16 GW | Strombedarf mehrerer Millionen US-Haushalte |
| Kapazität (Installiert) | Region / Nutzung | Bemerkung |
|---|---|---|
| 5 GW (2025) | USA gesamt | aktuelle KI-Rechenzentren (Training + Inferenz) |
| 50 GW (2030, Szenario) | USA gesamt | entspricht ~5 % der US-Erzeugungskapazität |
| >100 GW (2030, Szenario) | Weltweit | Summe aller KI-Rechenzentren, Training und Inferenz |
Die obigen Werte beziehen sich entweder auf den Strombedarf einzelner Trainingsläufe (erste Tabelle) oder auf die gesamte installierte KI-Rechenzentrumskapazität (zweite Tabelle). Letztere umfasst neben dem Training auch den wachsenden Anteil an Inferenzleistungen. Damit ist die Nutzung trainierter Modelle im praktischen Einsatz gemeint, zum Beispiel wenn ein Sprachmodell Fragen beantwortet oder ein Bildklassifikator neue Eingaben verarbeitet.
Hintergrund dieses Wachstums ist das Zusammenspiel mehrerer Faktoren: Der Trainingsaufwand wächst mit etwa 4–5x pro Jahr, während die Stromlast mit etwa 2,2x pro Jahr steigt. Hinzu kommen Effizienzsteigerungen von 26 bis 40 Prozent jährlich. Die Trainingsdauern, die in der Vergangenheit um 26 bis 50 Prozent pro Jahr zunahmen, dürften sich hingegen verlangsamen und künftig nur noch um 10 bis 20 Prozent pro Jahr wachsen. Diese Faktoren bremsen zwar das exponentielle Wachstum, können es jedoch nicht vollständig kompensieren.
Technische und organisatorische Engpässe
Diese Entwicklung beeinflusst direkt die Stromlast und stellt einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor dar.
Epoch AI hat auch untersucht, ob die bisherige Skalierung der KI auch über 2030 hinaus möglich bleibt. Dabei werden vier potenzielle Engpässe genannt:
- Stromversorgung: Gigawatt-große Trainingsjobs belasten bereits heute regionale Netze.
- Chipproduktion: Die Fertigungskapazitäten müssen weiter drastisch steigen.
- Datenverfügbarkeit: Natürliche Sprach- und Textdaten stoßen an Grenzen, weshalb synthetische Daten oder Lizenzmodelle nötig werden.
- Latenzgrenzen: Mit wachsender Modellgröße entstehen technische Barrieren durch Verzögerungen in der Datenübertragung.
Man kommt dennoch zum Schluss, dass bis 2030 Trainingsläufe im Umfang von rund 2e29 FLOP (also 2 × 10^29 FLOP) technisch möglich sind – ein Ausmaß, das grob der Relation zwischen GPT-2 und GPT-4 entspricht.
Regionale Unterschiede
Während in den USA einzelne Cluster wie Nord-Virginia jährliche Zubauten von mehreren hundert Megawatt verzeichnen, verläuft das Wachstum in Europa deutlich langsamer. In den fünf größten Märkten (Frankfurt, London, Amsterdam, Paris, Dublin) kamen 2024 zusammen weniger als 400 Megawatt hinzu, die Leerstandsrate in Frankfurt liegt bereits unter vier Prozent. Auch die Bundesregierung prognostiziert einen Anstieg des Strombedarfs deutscher Rechenzentren von heute etwa 20 Terawattstunden pro Jahr auf bis zu 35 Terawattstunden im Jahr 2030 und 88 TWh im Jahr 2045. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Europa zwar betroffen ist, aber nicht im gleichen Tempo wächst wie die USA.
Auswirkungen auf den Energiesektor
Besonders relevant ist die Möglichkeit von Distributed Training: Hierbei wird das Training über mehrere Standorte verteilt, um Gigawatt-Lasten auf einzelne Rechenzentren und zu vermeiden und zu verteilen. DeepMind hat bereits gezeigt, dass Modelle über mehrere Campi hinweg trainiert werden können.
Die absehbare Entwicklung hat gravierende Konsequenzen für Energieversorger und Netzbetreiber:
- Netzplanung: Einzelne KI-Rechenzentren erreichen den Verbrauch ganzer Städte und müssen frühzeitig in Ausbauplanungen einbezogen werden.
- Versorgungssicherheit: Die Belastung kann zu Spannungsabfällen und Netzinstabilitäten führen, wenn keine Gegenmaßnahmen erfolgen. In den USA wurden beispielsweise in Ballungsräumen vermehrt Oberschwingungen im Stromnetz gemessen, die mit KI-Rechenzentren in Zusammenhang gebracht werden. Diese Verzerrungen können die Stromqualität beeinträchtigen und im Extremfall sogar Haushaltsgeräte beschädigen oder Brandgefahren erhöhen.
- Klimapolitik: Ein steigender Energiebedarf erschwert die Dekarbonisierungsziele, auch wenn Betreiber zunehmend auf erneuerbare Energien setzen. Europäische Szenarien wie die Prognosen der Bundesregierung (Verdopplung des Verbrauchs deutscher Rechenzentren bis 2037) verdeutlichen, dass diese Herausforderung international relevant ist.
- Regulierung: In Szenarien könnte KI bis 2030 etwa 5 % der US-Erzeugungskapazität binden. Dies wirft Fragen nach politischen Leitlinien und Rahmenbedingungen auf.
- Distributed Training: Technisch ist es zunehmend möglich, Trainings über mehrere Standorte zu verteilen. So hat DeepMind bereits Modelle über mehrere Rechenzentrums-Campi trainiert. Damit könnte die Belastung einzelner Standorte künftig reduziert werden.
Fazit und Ausblick
Die derzeitigen Prognosen zeichnen ein klares Bild: Künstliche Intelligenz entwickelt sich zu einem der größten Treiber des globalen Strombedarfs. Während Effizienzsteigerungen und neue Hardware-Generationen den Trend verlangsamen, bleibt das Wachstum insgesamt exponentiell. Für den Energiesektor bedeutet dies, dass Strategien für Netzausbau, Standortwahl und nachhaltige Versorgung deutlich beschleunigt werden müssen.
Darüber hinaus ist ein politischer und gesellschaftlicher Diskurs erforderlich: Welche Regulierungen sind notwendig, um Netzstabilität und Klimaziele zu sichern? Welche Rolle können internationale Kooperationen und technologische Innovationen spielen, um den Energiehunger der KI in nachhaltige Bahnen zu lenken?
FAQ
Wie hoch ist der Strombedarf einzelner KI-Trainings heute und in Zukunft?
Derzeit benötigen Trainingsläufe führender Modelle rund 100–150 MW. Bis 2028 könnten es 1–2 GW sein, bis 2030 sogar 4–16 GW.
Wie lässt sich dieser Energiebedarf veranschaulichen?
100 MW entsprechen etwa 80.000–100.000 Haushalten. 1 GW versorgt eine Stadt mit rund 1 Mio. Einwohnern, 16 GW mehrere Millionen Haushalte.
Wie groß ist die gesamte installierte KI-Kapazität?
In den USA liegt sie 2025 bei rund 5 GW. Bis 2030 könnten es über 50 GW sein, weltweit mehr als 100 GW – inklusive Training und Inferenz.
Was bedeutet Inferenzleistung?
Darunter versteht man den praktischen Einsatz trainierter Modelle, z. B. wenn ein Sprachmodell Fragen beantwortet oder ein Bildklassifikator Eingaben verarbeitet.
Welche Faktoren treiben den steigenden Strombedarf?
Der Trainingsaufwand wächst etwa 4–5x pro Jahr, die Stromlast 2,2x. Hardware wird 26–40 % effizienter pro Jahr, Trainingsdauern verlängern sich langsamer.
Welche Engpässe sind absehbar?
Zentrale Bottlenecks sind die Stromversorgung, Chipproduktion, Datenverfügbarkeit und Latenz. Strom gilt als entscheidender Engpass für die Skalierung.
Wie unterscheiden sich USA und Europa?
Während die USA jährliche Zubauten von Hunderten MW sehen, wuchs die Kapazität in den fünf größten europäischen Märkten 2024 um weniger als 400 MW. In Deutschland soll der Rechenzentrumsverbrauch bis 2037 von 20 auf 38 TWh steigen.
Welche Auswirkungen gibt es auf Stromnetze?
Rechenzentren können Spannungsabfälle und Oberschwingungen verursachen, die Netzstabilität gefährden und Stromqualität verschlechtern.
Welche Lösungen gibt es?
Eine Option ist Distributed Training: Trainings über mehrere Standorte verteilen, um Gigawatt-Lasten zu vermeiden. Zudem sind Netz- und Standortplanung entscheidend.
Welche Rolle spielt Regulierung?
KI könnte bis 2030 etwa 5 % der US-Erzeugungskapazität binden. Politik und internationale Kooperationen müssen Rahmenbedingungen für Netzstabilität und Klimaziele schaffen.